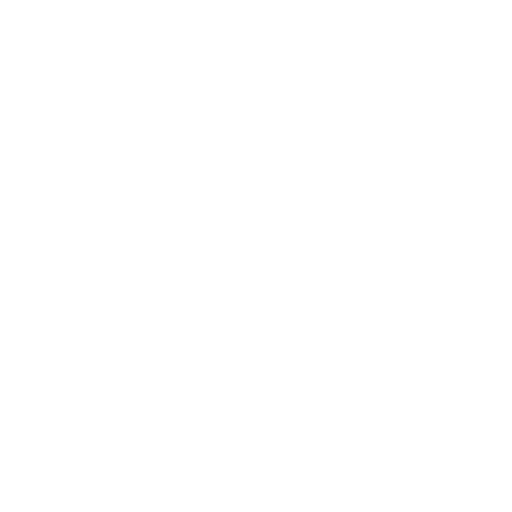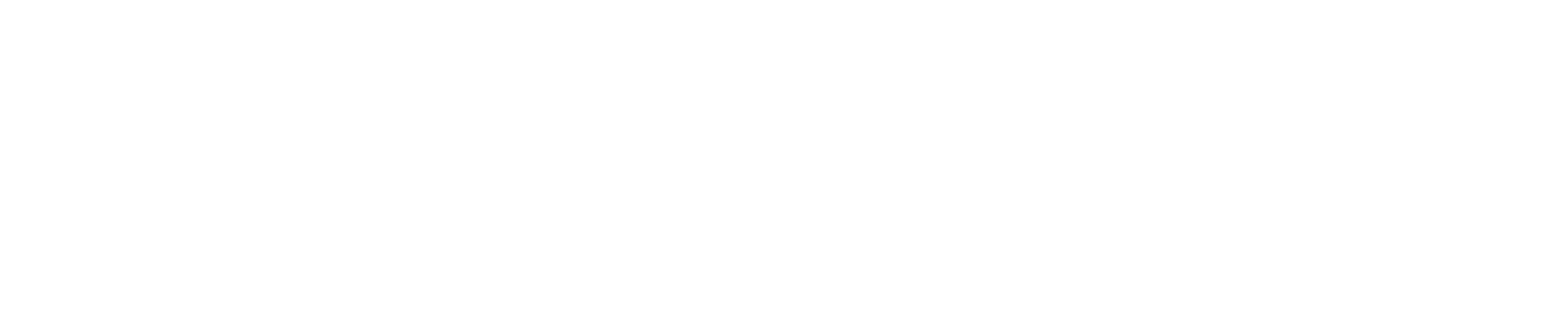Beratung?
Haben Sie Fragen zur Vorbereitung?
Wir beraten Sie gerne!
Wir beraten Sie gerne!
Lerncoaching für die Gymiprüfung
Wie wird ein Aufsatz an der Gymiprüfung beurteilt?
Erfahre in diesem Artikel, wie Aufsätze an der Zürcher Gymiprüfung (ZAP) bewertet werden:
Kriterien, Aufbau, Sprache & Inhalt.
Mit Tipps für bessere Aufsatz-Noten.
von: Sandra Zogg
Kriterien, Aufbau, Sprache & Inhalt.
Mit Tipps für bessere Aufsatz-Noten.
von: Sandra Zogg
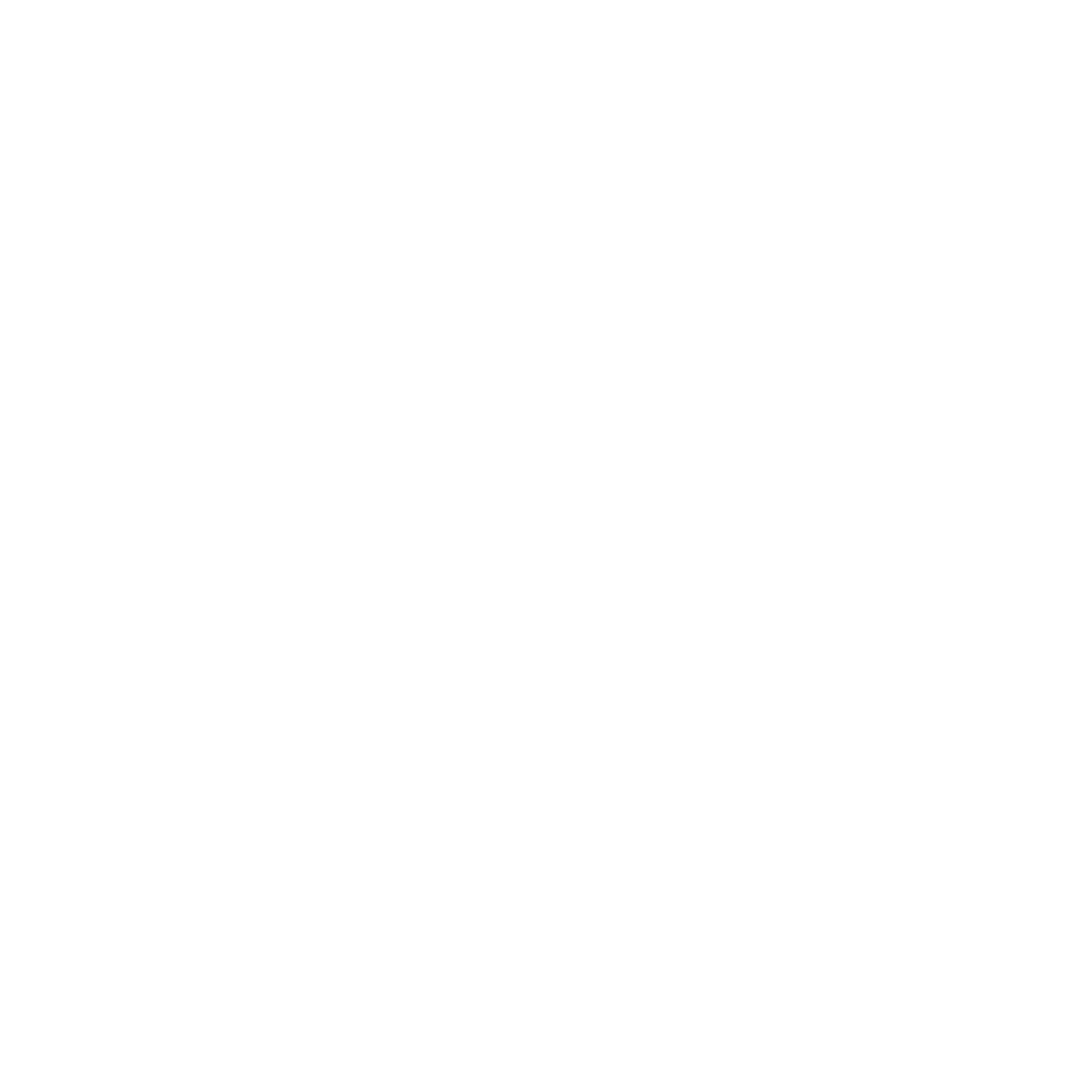
Das Kriterienraster der ZAP besteht aus drei Teilen.
Der Aufsatz entscheidet an der Gymiprüfung oft über Bestehen oder Scheitern. Viele Eltern sind erstaunt, wenn sprachlich praktisch fehlerfreie Texte trotzdem mit «ungenügend» bewertet werden. Meist, weil das Thema verfehlt oder der Auftrag nicht erfüllt wurde. Tatsächlich macht der Aufsatz im Kanton Zürich einen Viertel der Gesamtprüfungsnote aus und verlangt von den Schüler:innen eine anspruchsvolle Leistung: Sie müssen in kurzer Zeit einen zusammenhängenden, klar strukturierten und sprachlich überzeugenden Text zu einem vorgegebenen Thema verfassen.
Die Grundlage der Bewertung bildet oft das offizielle Kriterienraster für den Prüfungsteil «Verfassen eines Textes». Es gliedert die Beurteilung in drei Hauptbereiche: Inhalt, Aufbau und Sprache – und legt fest, nach welchen Fragen die Prüfenden den Text beurteilen. Dieses Raster ist kein Detaildokument für Lehrpersonen, sondern der Schlüssel zur Note. Es schafft Transparenz, Vergleichbarkeit und Fairness und gibt Schüler:innen eine klare Orientierung, worauf es wirklich ankommt.
Die Grundlage der Bewertung bildet oft das offizielle Kriterienraster für den Prüfungsteil «Verfassen eines Textes». Es gliedert die Beurteilung in drei Hauptbereiche: Inhalt, Aufbau und Sprache – und legt fest, nach welchen Fragen die Prüfenden den Text beurteilen. Dieses Raster ist kein Detaildokument für Lehrpersonen, sondern der Schlüssel zur Note. Es schafft Transparenz, Vergleichbarkeit und Fairness und gibt Schüler:innen eine klare Orientierung, worauf es wirklich ankommt.
Offizielles Kriterienraster für die Beurteilung des Prüfungsteils «Verfassen eines Textes» an der Gymiprüfung (ZAP), Prüfung 2025
Inhalt:
- Ist der Text auf das Thema ausgerichtet? Wird er der Aufgabenstellung gerecht?
- Ist das Geschriebene inhaltlich plausibel?
- Liegen dem Text überzeugende Ideen zugrunde? Ist er in besonderer Weise eigenständig?
- Stehen Inhalt und Umfang in einem sinnvollen Verhältnis?
- Ist das Geschriebene sachlich richtig und relevant? (nur für Kurzgymnasium)
- Ist der Text kohärent?
- Lässt er eine innere oder äussere Gliederung erkennen?
- Gibt es unnötige Wiederholungen oder Widersprüche?
- Ist der Text argumentativ schlüssig? (nur für Kurzgymnasium)
- Setzt der Text in der Aufgabenstellung verlangte Textmuster um?
- Wird anschaulich beschrieben und erzählt?
- Entspricht der Text grammatisch oder orthografisch dem Lernstand? Werden auch die Satzzeichen richtig verwendet?
- Ist die Wortwahl abwechslungsreich, präzise und angemessen? Werden standardsprachliche Wörter verwendet?
- Ist der Satzbau variabel? Ist er korrekt?
- Kommen besondere sprachliche Mittel zum Einsatz?
Inhalt:
Themenbezug, Plausibilität und Eigenständigkeit
Der erste Bewertungsbereich betrifft den Inhalt. Hier prüfen die Korrektor:innen, ob der Text auf das Thema ausgerichtet ist und der Aufgabenstellung gerecht wird. Wer das Thema verfehlt, kann keinen hohen Inhaltspunkt erzielen – egal, wie sprachlich sicher der Text ist. Der Themenbezug bildet also das Fundament jeder Bewertung.
Zum Inhalt gehört zudem, dass das Geschriebene plausibel und eigenständig ist. Ein guter Aufsatz zeigt eigene Gedanken, überzeugende Ideen und ein klares Verständnis dafür, was verlangt ist. Wenn im Auftrag Realitätsnähe gefordert wird, soll die Geschichte glaubwürdig bleiben. Wenn eine Stellungnahme verlangt ist, muss die Argumentation nachvollziehbar und nicht rein gefühlsbasiert sein. Gerade beim Kurzzeitgymnasium wird zusätzlich die sachliche Richtigkeit geprüft: Fakten und Bezüge sollen stimmen.
Auch Umfang und Gehalt müssen in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Ein halber Aufsatz mit zwei Ereignissen wirkt unausgeglichen, ein zu langer Text verliert schnell Struktur. Ein ausgewogener, vollständiger, aber kompakter Text überzeugt am meisten.
Typische Fehler beim Inhalt sind ein zu oberflächlicher Bezug zum Thema, lange Vorgeschichten ohne Relevanz oder das Übersehen von Auftragsteilen («Beende den Text mit einer Einsicht»). Auch die Textsorte ist zentral: Ein Bericht darf keine Fantasiegeschichte werden, und eine Erzählung (in der Regel) ebenso wenig. Genau das prüft das Raster unter dem Punkt «Wird der Aufgabe und der Textsorte entsprochen?»
Wer den Inhalt souverän meistert, zeigt Verständnis und Reife. Ein inhaltlich stimmiger Text beweist, dass das Kind die Aufgabe durchdrungen hat – und darauf baut die gesamte Bewertung auf.
Zum Inhalt gehört zudem, dass das Geschriebene plausibel und eigenständig ist. Ein guter Aufsatz zeigt eigene Gedanken, überzeugende Ideen und ein klares Verständnis dafür, was verlangt ist. Wenn im Auftrag Realitätsnähe gefordert wird, soll die Geschichte glaubwürdig bleiben. Wenn eine Stellungnahme verlangt ist, muss die Argumentation nachvollziehbar und nicht rein gefühlsbasiert sein. Gerade beim Kurzzeitgymnasium wird zusätzlich die sachliche Richtigkeit geprüft: Fakten und Bezüge sollen stimmen.
Auch Umfang und Gehalt müssen in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Ein halber Aufsatz mit zwei Ereignissen wirkt unausgeglichen, ein zu langer Text verliert schnell Struktur. Ein ausgewogener, vollständiger, aber kompakter Text überzeugt am meisten.
Typische Fehler beim Inhalt sind ein zu oberflächlicher Bezug zum Thema, lange Vorgeschichten ohne Relevanz oder das Übersehen von Auftragsteilen («Beende den Text mit einer Einsicht»). Auch die Textsorte ist zentral: Ein Bericht darf keine Fantasiegeschichte werden, und eine Erzählung (in der Regel) ebenso wenig. Genau das prüft das Raster unter dem Punkt «Wird der Aufgabe und der Textsorte entsprochen?»
Wer den Inhalt souverän meistert, zeigt Verständnis und Reife. Ein inhaltlich stimmiger Text beweist, dass das Kind die Aufgabe durchdrungen hat – und darauf baut die gesamte Bewertung auf.
Aufbau:
Struktur, Logik und Textmuster
Der zweite Bereich, der Aufbau, beschreibt, wie klar und logisch ein Text gegliedert ist. Im Raster heisst es: Ist der Text kohärent? Lässt sich eine innere oder äussere Gliederung erkennen? Gibt es unnötige Wiederholungen oder Widersprüche? Diese Fragen zielen auf die Lesbarkeit ab: Verläuft die Geschichte oder Argumentation nachvollziehbar? Gibt es eine erkennbare Einleitung, einen durchdachten Hauptteil und einen runden Schluss?
Viele Schüler:innen verlieren hier Punkte, weil sie ohne Plan schreiben. Das führt zu sprunghaften Texten, plötzlichen Zeitsprüngen oder fehlenden Schlusspassagen. Andere vergessen Absätze oder wiederholen denselben Gedanken mehrfach. Für die Prüfenden sind solche Texte anstrengend zu lesen. Sie wirken unfertig und unstrukturiert.
Ein guter Aufbau folgt einer klaren Dramaturgie.
In einer Erzählung heisst das: Einleitung –Hauptteil – Höhepunkt – Schluss.
Im Bericht: Ereignisreihenfolge – sachlich geordnet, mit Zeugenaussagen ausgebaut. Eine Stellungnahme/Argumentation (Kurzzeit): Einleitung – Pro/Kontra – Fazit mit eigener Meinung (je nach Aufgabenstellung!).
Auch die Übergänge zwischen den Abschnitten sind entscheidend: Wörter wie «währenddessen», «plötzlich», «wie aus dem Nichts» oder Adjektive wie «freudig», « aufgeregt» oder «skeptisch» leiten die Leser:innen elegant weiter.
Zur Aufbaukompetenz gehört ausserdem, das Textmuster der Aufgabenstellung umzusetzen. Ein Aufsatz, der zwar spannend ist, aber die verlangte Textsorte ignoriert, erfüllt das Raster nicht. Und Spannung muss auch ohne einen «Krimi-Touch» spannend sein können: Planung ist daher zentral. Wer vor dem Schreiben ein kurzes Mindmap oder eine Stichwortgliederung erstellt, schreibt strukturierter, vermeidet Wiederholungen und spart am Ende Zeit beim Überarbeiten.
Ein strukturierter Aufsatz signalisiert Lesekompetenz, Denkordnung und sprachliche Reife – genau das, was die Gymiprüfung testen will.
Viele Schüler:innen verlieren hier Punkte, weil sie ohne Plan schreiben. Das führt zu sprunghaften Texten, plötzlichen Zeitsprüngen oder fehlenden Schlusspassagen. Andere vergessen Absätze oder wiederholen denselben Gedanken mehrfach. Für die Prüfenden sind solche Texte anstrengend zu lesen. Sie wirken unfertig und unstrukturiert.
Ein guter Aufbau folgt einer klaren Dramaturgie.
In einer Erzählung heisst das: Einleitung –Hauptteil – Höhepunkt – Schluss.
Im Bericht: Ereignisreihenfolge – sachlich geordnet, mit Zeugenaussagen ausgebaut. Eine Stellungnahme/Argumentation (Kurzzeit): Einleitung – Pro/Kontra – Fazit mit eigener Meinung (je nach Aufgabenstellung!).
Auch die Übergänge zwischen den Abschnitten sind entscheidend: Wörter wie «währenddessen», «plötzlich», «wie aus dem Nichts» oder Adjektive wie «freudig», « aufgeregt» oder «skeptisch» leiten die Leser:innen elegant weiter.
Zur Aufbaukompetenz gehört ausserdem, das Textmuster der Aufgabenstellung umzusetzen. Ein Aufsatz, der zwar spannend ist, aber die verlangte Textsorte ignoriert, erfüllt das Raster nicht. Und Spannung muss auch ohne einen «Krimi-Touch» spannend sein können: Planung ist daher zentral. Wer vor dem Schreiben ein kurzes Mindmap oder eine Stichwortgliederung erstellt, schreibt strukturierter, vermeidet Wiederholungen und spart am Ende Zeit beim Überarbeiten.
Ein strukturierter Aufsatz signalisiert Lesekompetenz, Denkordnung und sprachliche Reife – genau das, was die Gymiprüfung testen will.
Sprache:
Ausdruck, Korrektheit und Wirkung
Der dritte Bewertungsbereich betrifft die Sprache. Und dieser Punkt umfasst mehr, als viele denken. Im Raster heisst es: Wird anschaulich beschrieben oder erzählt? Entspricht der Text grammatisch oder orthografisch dem Lernstand? Ist die Wortwahl abwechslungsreich, präzise und angemessen? Ist der Satzbau variabel und korrekt? Kommen besondere sprachliche Mittel zum Einsatz?
Es heisst: Sprache wird sowohl unter dem Aspekt der Ausdruckskraft, als auch der Sprachrichtigkeit beurteilt. Ein sprachlich guter Aufsatz ist klar, abwechslungsreich, korrekt und der Situation angepasst. Das beginnt bei der Wortwahl: Statt «machen» oder «gehen» können treffendere Verben wie «gestalten», «stürmen» oder «schleichen» verwendet werden. Auch Adjektive und sinnliche Beschreibungen beleben den Text, solange sie nicht übertrieben wirken. Die Sprache sollte standardsprachlich sein, also ohne Umgangsformen oder Dialekt.
Unter Sprachrichtigkeit verstehen die Prüfenden eine solide Beherrschung von Grammatik, Orthografie und Zeichensetzung. Einzelne Flüchtigkeitsfehler sind kein Problem, doch viele oder auffällige Fehler trüben den Gesamteindruck. Besonders häufig sind die Fehler bei der Kommasetzung, bei der Unterscheidung von «das» und «dass» oder bei Zeitformen. Wer im Präteritum beginnt, sollte nicht plötzlich ins Präsens wechseln.
Ein sauberer, sprachlich kontrollierter Text wirkt reif und vertrauenswürdig. Ein Aufsatz mit vielen Fehlern dagegen signalisiert, dass sie Grundlagen noch unsicher sind, selbst wenn der Inhalt interessant ist. Deshalb lohnt sich eine gezielte Rechtschreibkorrektur am Schluss. Ein bewährter Trick: Den Text rückwärts lesen, Wort für Wort. So erkennt man Rechtschreibfehler, Endungen und Buchstabendreher, die man beim normalen Lesen übersehen würde.
Es heisst: Sprache wird sowohl unter dem Aspekt der Ausdruckskraft, als auch der Sprachrichtigkeit beurteilt. Ein sprachlich guter Aufsatz ist klar, abwechslungsreich, korrekt und der Situation angepasst. Das beginnt bei der Wortwahl: Statt «machen» oder «gehen» können treffendere Verben wie «gestalten», «stürmen» oder «schleichen» verwendet werden. Auch Adjektive und sinnliche Beschreibungen beleben den Text, solange sie nicht übertrieben wirken. Die Sprache sollte standardsprachlich sein, also ohne Umgangsformen oder Dialekt.
Unter Sprachrichtigkeit verstehen die Prüfenden eine solide Beherrschung von Grammatik, Orthografie und Zeichensetzung. Einzelne Flüchtigkeitsfehler sind kein Problem, doch viele oder auffällige Fehler trüben den Gesamteindruck. Besonders häufig sind die Fehler bei der Kommasetzung, bei der Unterscheidung von «das» und «dass» oder bei Zeitformen. Wer im Präteritum beginnt, sollte nicht plötzlich ins Präsens wechseln.
Ein sauberer, sprachlich kontrollierter Text wirkt reif und vertrauenswürdig. Ein Aufsatz mit vielen Fehlern dagegen signalisiert, dass sie Grundlagen noch unsicher sind, selbst wenn der Inhalt interessant ist. Deshalb lohnt sich eine gezielte Rechtschreibkorrektur am Schluss. Ein bewährter Trick: Den Text rückwärts lesen, Wort für Wort. So erkennt man Rechtschreibfehler, Endungen und Buchstabendreher, die man beim normalen Lesen übersehen würde.
Wie die Prüfungsexperten:innen an der Gymiprüfung (ZAP) lesen – und warum das Raster Sicherheit gibt
Viele Eltern fragen sich, ob die Bewertung von Aufsätzen nicht letztlich doch subjektiv ist. Tatsächlich versucht das Raster genau das zu vermeiden: Es schafft klare Leitfragen, die alle Korrektor:innen anwenden. Dennoch sollte man wissen, dass auch hier Menschen am Werk sind. In der Regel wird jeder Aufsatz zunächst von einer Person korrigiert und anschliessend von einer zweiten gegengelesen, die überprüft, ob sie mit der Einschätzung übereinstimmt. Dieses Vier-Augen-Prinzip sorgt für Fairness und Ausgewogenheit – trotzdem spielen Wahrnehmung und Lesefluss eine Rolle.
Hier kommt der sogenannte Halo-Effekt ins Spiel, ein psychologisches Phänomen, das auch bei Leistungsbeurteilungen wirkt. Ein positiver Gesamteindruck zu Beginn, etwa durch eine saubere Handschrift, klare Struktur, weniger Korrekturen und eine interessante Einleitung, färbt unbewusst auf die Bewertung der übrigen Kriterien ab. Ein Aufsatz, der von Anfang an «sorgfältig» wirkt, wird oft auch im Inhalt oder Aufbau als stärker wahrgenommen. Genau deshalb ist Rechtschreibung und formale Sorgfalt nicht nur Nebensache, sondern Teil des Gesamteindruckes: Sie zeigt, dass ein Kind kontrolliert arbeitet und sprachlich sicher ist.
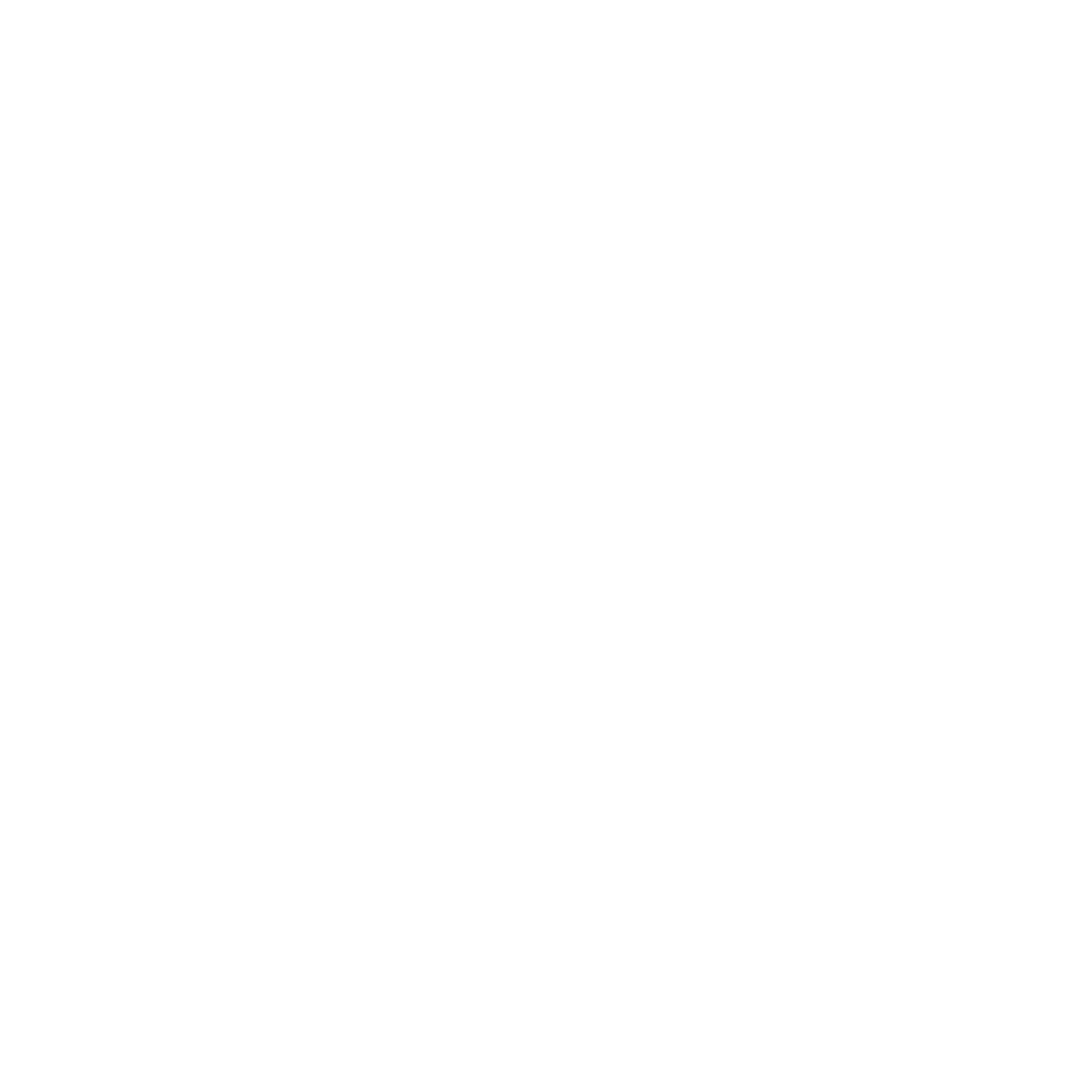
Die Prüfenden sind sich dessen bewusst, aber sie sind eben auch Menschen. Ein ordentlicher, gut lesbarer Text erleichtert das Lesen. Ein chaotischer oder fehlerhafter Text bremst die Aufmerksamkeit. Deshalb lohnt es sich doppelt, auf eine schöne Darstellung, Absätze, gleichmässige Schrift und Korrektheit zu achten.
Positiv fällt ein Text auf, wenn er über das Erwartbare hinausgeht. Das gelingt zum Beispiel, wenn drei Varianten der direkten Rede korrekt eingesetzt werden, wenn im Bericht sogar indirekte Rede im Konjunktiv erscheint, oder wenn die Einleitung die Spannung nicht bei null beginnen lässt, sondern gleich in die Handlung führt. Profis schaffen es, beim Höhepunkt Sinneseindrücke einzubauen (etwa Geräusche, Gerüche oder Körperreaktionen) und innere und äussere Handlungen zu verbinden. So kann etwa das Wetter die Stimmung spiegeln: Zunächst ziehen Wolken auf, dann tobt der Sturm und am Schluss bricht die Sonne durch. Wenn der Schluss schliesslich einen Bogen zur Einleitung schlägt, wirkt der Text geschlossen und professionell.
Doch all das gelingt nur mit Planung – nicht mit spontaner Inspiration.
Positiv fällt ein Text auf, wenn er über das Erwartbare hinausgeht. Das gelingt zum Beispiel, wenn drei Varianten der direkten Rede korrekt eingesetzt werden, wenn im Bericht sogar indirekte Rede im Konjunktiv erscheint, oder wenn die Einleitung die Spannung nicht bei null beginnen lässt, sondern gleich in die Handlung führt. Profis schaffen es, beim Höhepunkt Sinneseindrücke einzubauen (etwa Geräusche, Gerüche oder Körperreaktionen) und innere und äussere Handlungen zu verbinden. So kann etwa das Wetter die Stimmung spiegeln: Zunächst ziehen Wolken auf, dann tobt der Sturm und am Schluss bricht die Sonne durch. Wenn der Schluss schliesslich einen Bogen zur Einleitung schlägt, wirkt der Text geschlossen und professionell.
Doch all das gelingt nur mit Planung – nicht mit spontaner Inspiration.
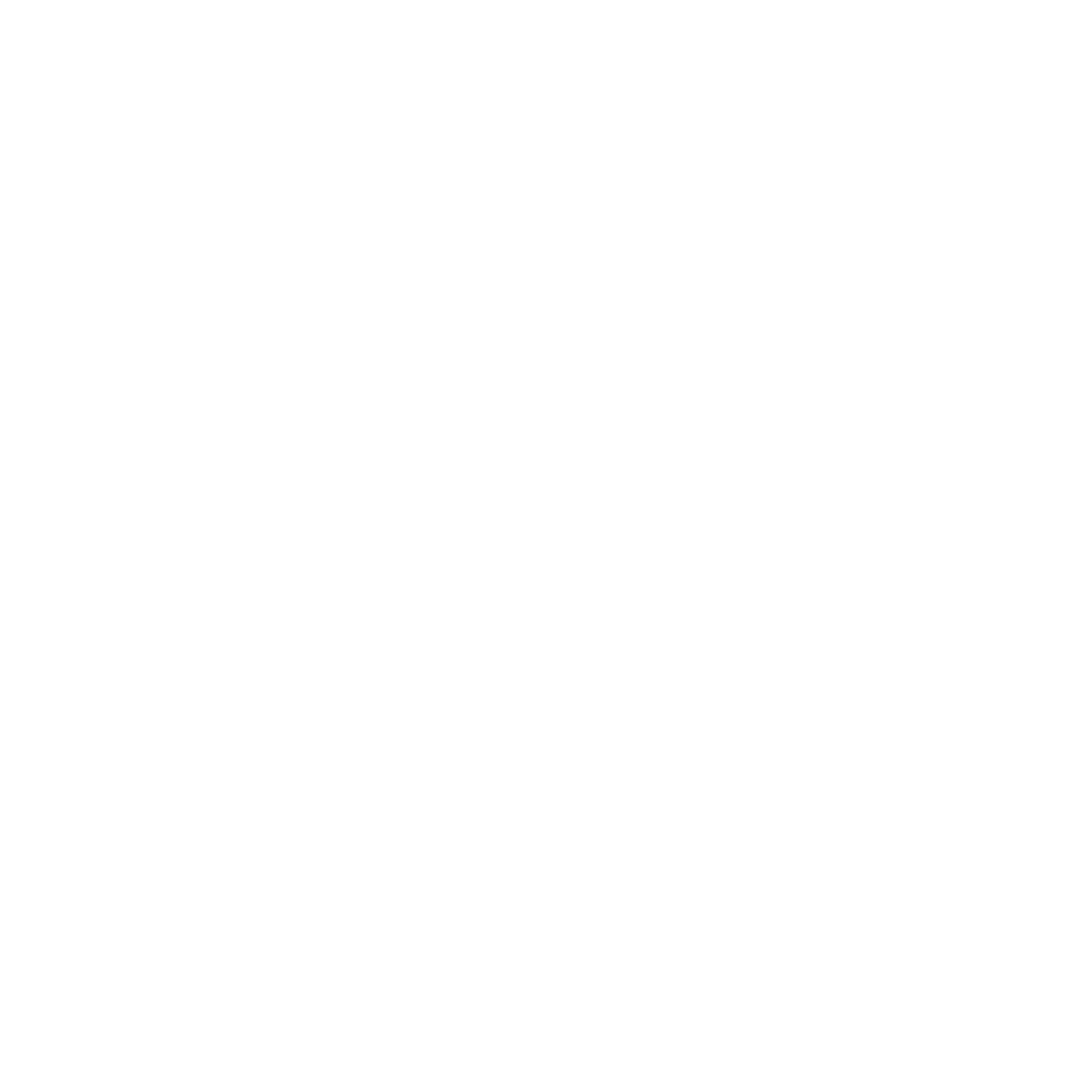
Fünf konkrete Tipps für den Aufsatz an der Gymiprüfung (ZAP)
1.
Textsorte und Thema wirklich treffen
Am Anfang lohnt sich eine kurze Planungsphase. Das Kind sollte die Aufgabenstellung genau lesen, Schlüsselbegriffe markieren und ein kleines Mindmap oder eine Gliederung machen. Es ist besser, in diesen drei Minuten zu merken, dass eine Idee nicht trägt, als mitten im Aufsatz festzustecken. Planung spart Zeit und verhindert Themenfehler.
Am Anfang lohnt sich eine kurze Planungsphase. Das Kind sollte die Aufgabenstellung genau lesen, Schlüsselbegriffe markieren und ein kleines Mindmap oder eine Gliederung machen. Es ist besser, in diesen drei Minuten zu merken, dass eine Idee nicht trägt, als mitten im Aufsatz festzustecken. Planung spart Zeit und verhindert Themenfehler.
2.
Signalwörter aus dem Auftrag durchziehen
Signalwörter aus der Aufgabenstellung, etwa «Versprechen», «Mut» oder «Erkenntnis», sollten nicht nur einmal auftauchen, sondern sich wie ein roter Faden durch den Text ziehen. Das zeigt, dass die Aufgabe verstanden wurde und der Text konsequent beim Thema bleibt.
Signalwörter aus der Aufgabenstellung, etwa «Versprechen», «Mut» oder «Erkenntnis», sollten nicht nur einmal auftauchen, sondern sich wie ein roter Faden durch den Text ziehen. Das zeigt, dass die Aufgabe verstanden wurde und der Text konsequent beim Thema bleibt.
3.
Einleitung gezielt gestalten
Besonders bei Erzählungen gilt: Die Einleitung sollte immer klären, wer, wann und wo etwas passiert. Ideal ist der Einstieg mit einer direkten Rede, weil sie sofort ins Geschehen führt. Zum Beispiel: «Julia, komm endlich runter, es gibt Frühstück!», rief meine Mutter quer durchs Haus.
Dieser einfache Satz deckt alle drei Elemente ab und fesselt sofort die Aufmerksamkeit.
Besonders bei Erzählungen gilt: Die Einleitung sollte immer klären, wer, wann und wo etwas passiert. Ideal ist der Einstieg mit einer direkten Rede, weil sie sofort ins Geschehen führt. Zum Beispiel: «Julia, komm endlich runter, es gibt Frühstück!», rief meine Mutter quer durchs Haus.
Dieser einfache Satz deckt alle drei Elemente ab und fesselt sofort die Aufmerksamkeit.
4.
Satzanfänge und Sprache variieren
Sätze sollten nicht immer gleich beginnen. Adjektive, Adverbien und unterschiedliche Satzstrukturen schaffen Abwechslung und Spannung. Eine lebendige Sprache hält die Aufmerksamkeit der Prüfenden und wirkt reif.
Und: Getraut euch, Kommas zu setzen! Sie machen Texte lesbarer und zeigen Sicherheit im Schreiben.
Sätze sollten nicht immer gleich beginnen. Adjektive, Adverbien und unterschiedliche Satzstrukturen schaffen Abwechslung und Spannung. Eine lebendige Sprache hält die Aufmerksamkeit der Prüfenden und wirkt reif.
Und: Getraut euch, Kommas zu setzen! Sie machen Texte lesbarer und zeigen Sicherheit im Schreiben.
5.
Saubere Darstellung und Rechtschreibung
Der erste Eindruck zählt. Eine klare Schrift, deutliche Absätze und Korrekturen mit Abdeckroller signalisieren Sorgfalt. Plane am Schluss fünf Minuten ein, um deinen Text Wort für Wort rückwärts zu lesen. So fallen Grossschreibfehler, falsche Endungen oder übersehene Buchstaben sofort auf. Dieses prüfende Lesen kann den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Aufsatz ausmachen.
Der erste Eindruck zählt. Eine klare Schrift, deutliche Absätze und Korrekturen mit Abdeckroller signalisieren Sorgfalt. Plane am Schluss fünf Minuten ein, um deinen Text Wort für Wort rückwärts zu lesen. So fallen Grossschreibfehler, falsche Endungen oder übersehene Buchstaben sofort auf. Dieses prüfende Lesen kann den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Aufsatz ausmachen.
Fazit
Das Kriterienraster macht die Aufsatzbewertung an der Gymiprüfung transparent und nachvollziehbar. Es zeigt klar, dass es nicht nur um «gut schreiben» geht, sondern um drei gleichwertige Bereiche: Inhalt, Aufbau und Sprache. Wer diese Struktur versteht, kann gezielt üben, Fortschritte messen und selbstbewusster an die Prüfung herangehen.
Für Eltern bedeutet das: Helfen Sie Ihrem Kind, die Aufgabenstellungen genau zu lesen, zu planen, sauber zu schreiben und am Ende zu kontrollieren. Und erinnern Sie es daran: Auch die Prüfenden sind Menschen. Sie freuen sich über Texte, die sorgfältig, klar und mit Herz geschrieben sind.
Wer das Raster kennt, kann sich bewusst darauf einstellen und Schritt für Schritt genau das üben, was an der Prüfung zählt.
Wir unterstützen Ihr Kind gerne auf diesem Weg.
Beste Grüsse
Sandra Zogg
Gymivorbereitung Zürich
Für Eltern bedeutet das: Helfen Sie Ihrem Kind, die Aufgabenstellungen genau zu lesen, zu planen, sauber zu schreiben und am Ende zu kontrollieren. Und erinnern Sie es daran: Auch die Prüfenden sind Menschen. Sie freuen sich über Texte, die sorgfältig, klar und mit Herz geschrieben sind.
Wer das Raster kennt, kann sich bewusst darauf einstellen und Schritt für Schritt genau das üben, was an der Prüfung zählt.
Wir unterstützen Ihr Kind gerne auf diesem Weg.
Beste Grüsse
Sandra Zogg
Gymivorbereitung Zürich
_____________
Quellen
Bildungsdirektion Kanton Zürich (2025). Zentrale Aufnahmeprüfung ins Gymnasium:
Hinweise und Beurteilungskriterien. Zürich: Mittelschul- und Berufsbildungsamt.
Offizielles Dokument mit dem Kriterienraster für den Prüfungsteil «Verfassen eines Textes».
Quellen des Rasters:
Baurmann, Jürgen: Ist das Benoten von Aufsätzen nur heikel, beschwerlich und schwierig? In: Ders.:
Schreiben – Überarbeiten – Beurteilen. Ein Arbeitsbesuch zur Schreibdidaktik. 2. Aufl. Seelze: Kallmeyer
2006, S. 125-148.
Becker-Mrotzek, Michael: Schreibleistungen bewerten und beurteilen. In: Feilke, Helmuth; Pohl, Thorsten
(Hrsg.): Schriftlicher Sprachgebrauch. Texte verfassen. Baltmannsweiler: Schneider 2014, S. 501-513
(= Deutschunterricht in Theorie und Praxis 4).
Isler, Dieter; Büchel, Elsbeth: Sprachfenster. Lehrmittel für den Sprachunterricht auf der Unterstufe. Hand-
buch. Linguoskop Schreiben. Lehrmittelverlag Zürich 2000.
Jost, Jörg; Böttcher, Ingrid: Leistungen messen, bewerten und beurteilen. In: Becker-Mrotzek, Michael;
Böttcher, Ingrid: Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. Unter Mitarbeit von Julia Dreher, Jörg Jost,
Frank Schneider und Klaus Tetling. 5. Aufl. Berlin: Cornelsen 2014, S. 113-144.
Merz-Grötsch, Jasmin: Texte schreiben lernen. Grundlagen, Methoden, Unterrichtsvorschläge. 2. Aufl.
Seelze: Kallmeyer 2014.
Steinig, W., & Huneke, H.-W. (2018). Grammatik lehren und lernen: Sprachdidaktik Deutsch. München: Wilhelm Fink Verlag.
Grundlage für sprachdidaktische Bewertungskriterien und Textkohärenz.
Brinker, K. (2018). Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Detaillierte Beschreibung von Textstruktur, Kohärenz und sprachlicher Wirkung.
Fix, U. (2020). Texte schreiben – Texte beurteilen: Sprachwissenschaftliche Grundlagen der Schreibdidaktik. Tübingen: Narr Francke Attempto.
Differenzierte Analyse der Kriterien Inhalt, Aufbau und Sprache bei schulischen Schreibaufgaben.
Rupp, A., & Rietzler, N. (2022). Lernen mit Erfolg: Wie Kinder Konzentration, Motivation und Schreibkompetenz entwickeln. München: Beltz.
Pädagogische Perspektive auf Schreibentwicklung und Prüfungsbewältigung.
Müller, M., & Schneider, C. (2021). Aufsatzkompetenz fördern: Von der Idee zum Text. Bern: Haupt Verlag.
Praxisorientierte Methoden zur Förderung von Planungs-, Strukturierungs- und Überarbeitungskompetenz im Aufsatzunterricht.
Rogers, T., & Feller, A. (2016). Discouraged by Peer Excellence: Exposure to Exemplary Peer performance Causes Quitting. Psychological Science, 27(3), 365-374. https://doi.org/10.1177/0956797615623770
Über uns
- Wir sind das Kompetenzzentrum für die Gymivorbereitung im Kanton Zürich.
- Bei uns unterrichten nur ausgebildete Lehrpersonen mit langjähriger Erfahrung rund um den Übertritt.
- Als kleines Lehrer:innen-Team ist für uns eine enge Betreuung zentral, weshalb wir auch ausserhalb der Kurszeiten für unsere Schüler:innen stets da sind.
- Struktur und Organisation sind fürs Gymnasium entscheidend – wir geben dies mit auf den Weg.
- Wir fördern die Selbstständigkeit sowie Eigenverantwortung Ihres Kindes und informieren Sie laufend über dessen Lernstand.
- Freude und Begeisterung sind uns wichtig.
- Wir begleiten Ihr Kind nicht nur fachlich, sondern auch mental auf dem Weg zur Gymiprüfung.
Unsere Kursstandorte
Unsere Kursstandorte befinden sich immer an sehr zentralen Lagen, welche ideal mit dem ÖV erreichbar sind. Unsere Schüler und Schülerinnen erwarten moderne Räumlichkeiten, welche mit den neusten Medien ausgestattet sind.
Unser Kursort direkt beim
Zürich Hauptbahnhof
Zürich Hauptbahnhof
Lagerstrasse 2
8090 Zürich
8090 Zürich
Unser Kursort direkt beim
Bahnhof Stadelhofen
Bahnhof Stadelhofen
Falkenstrasse 28A
8008 Zürich
8008 Zürich
Unser Kursort direkt beim
Bahnhof Winterthur
Bahnhof Winterthur
Schaffhauserstrasse 2
8400 Winterthur
8400 Winterthur