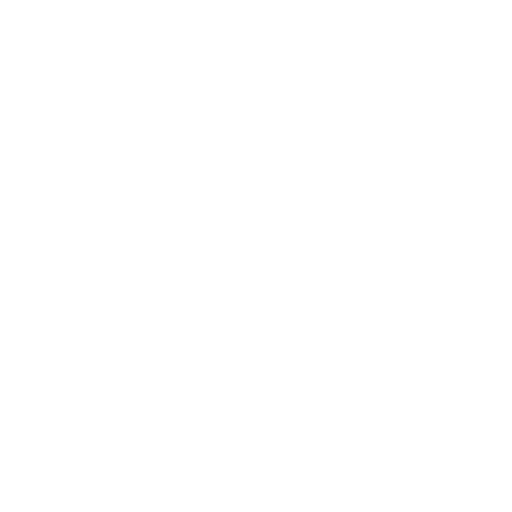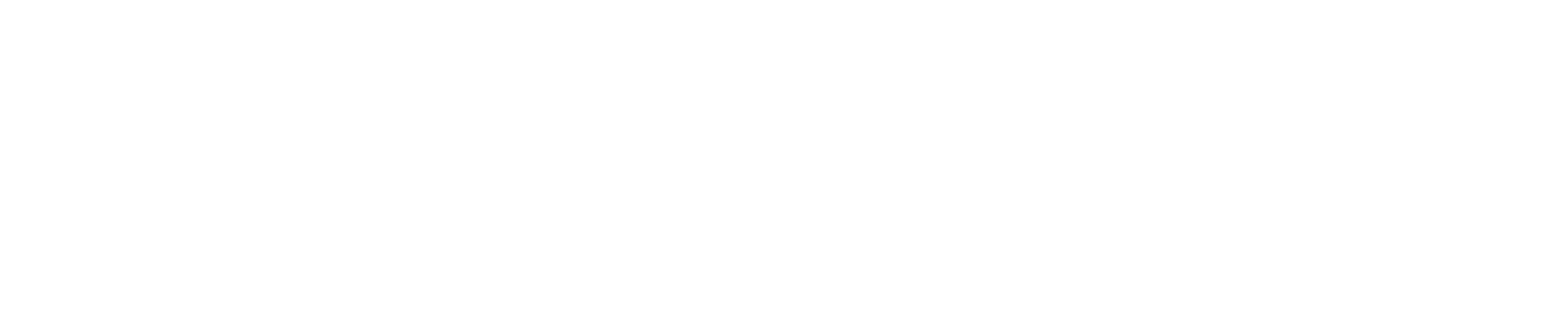Beratung?
Haben Sie Fragen zur Vorbereitung?
Wir beraten Sie gerne!
Wir beraten Sie gerne!
Lerncoaching für die Gymiprüfung
Rechtschreibung als Schlüssel im Bildungsdschungel
Rechtschreibung ist weit mehr als Regelwissen. Sie ist Schlüssel zu Ausdruckskraft, Selbstvertrauen und schulischem Erfolg. Dieser Artikel zeigt, wie die Zürcher Gymiprüfung (ZAP) Orthografie bewertet, warum der sogenannte «Halo-Effekt» Aufsatznoten verzerren kann und welche zehn erprobten Methoden Kindern helfen, sicherer zu schreiben. Kinder lernen, Fehler wirklich zu verstehen anstatt, sie zu fürchten.
Denn: Wer die Sprache zähmt, zähmt auch den Tiger.
von: Sandra Zogg
Liebe Eltern,
Wie steht es eigentlich um die Rechtschreibung Ihres Kindes?
Vielleicht kennen Sie das: Sie schauen die Hausaufgaben durch, sehen einen Fehler nach dem anderen und fragen sich leise, wie das bloss bei der Gymiprüfung gut gehen soll...
Der Rechtschreibdschungel ist dicht, die Wege wirken verworren. Manchmal steht man als Eltern ganz alleine da. Mitten im Unterholz, ohne Karte, ohne Guide, während rundherum alles ein bisschen unübersichtlich rauscht.
Wie steht es eigentlich um die Rechtschreibung Ihres Kindes?
Vielleicht kennen Sie das: Sie schauen die Hausaufgaben durch, sehen einen Fehler nach dem anderen und fragen sich leise, wie das bloss bei der Gymiprüfung gut gehen soll...
Der Rechtschreibdschungel ist dicht, die Wege wirken verworren. Manchmal steht man als Eltern ganz alleine da. Mitten im Unterholz, ohne Karte, ohne Guide, während rundherum alles ein bisschen unübersichtlich rauscht.
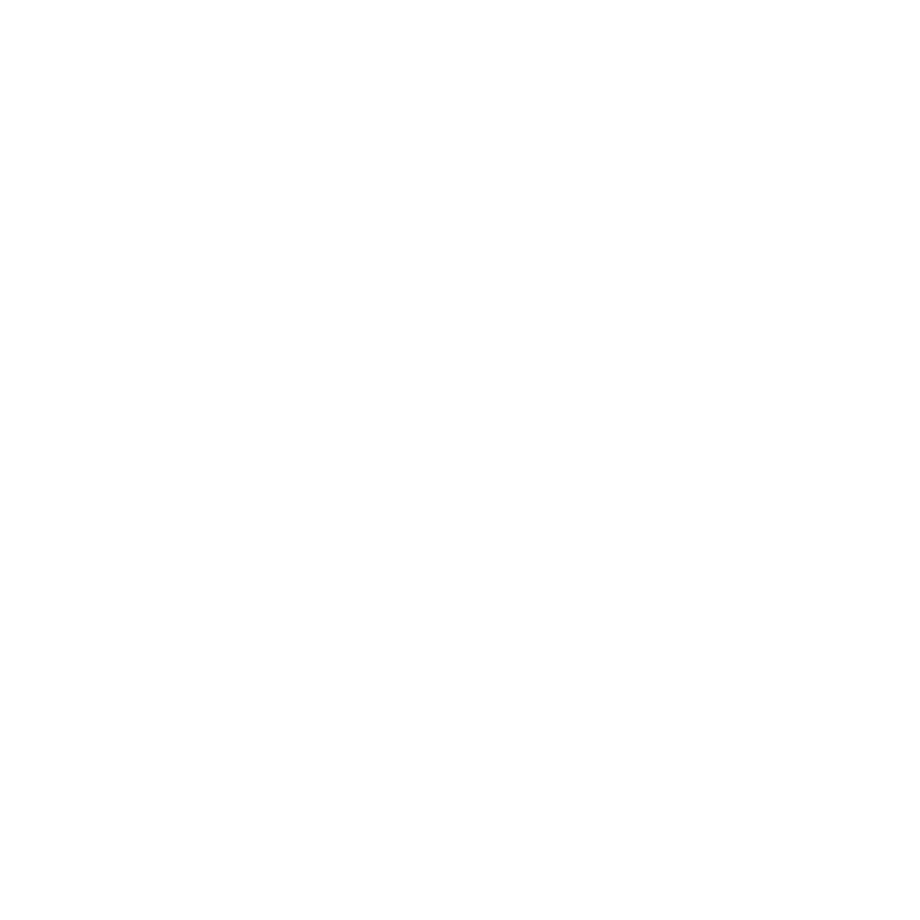
Apropos Dschungel: Erinnern Sie sich an das Dschungelbuch von Rudyard Kipling?
Es erzählt von Mogli, dem Menschenjungen, der bei Wölfen aufwächst und auf den es jemand abgesehen hat: Shere Khan, der furchteinflössende Tiger, der die Menschen hasst. Mogli muss fliehen. Dorthin, wo Sicherheit und Verantwortung warten: zu Seinesgleichen, ins Menschendorf. Bagheera, der Panther, macht sich mit ihm auf den Weg; doch Mogli möchte bleiben, und als Balu, der Bär, ihm erklärt, dass mit Gemütlichkeit alles gut werde, erst recht.
Im Laufe der Geschichte kommen jedoch immer mehr Gefahren auf Mogli zu und wir erfahren: Für Shere Khan gibt es nichts, was er mehr fürchtet als das Feuer der Menschen: die «rote Blume». Am Ende ist es genau dieses Feuer, mit dem Mogli den mächtigen Tieger in die Flucht schlägt.
Es erzählt von Mogli, dem Menschenjungen, der bei Wölfen aufwächst und auf den es jemand abgesehen hat: Shere Khan, der furchteinflössende Tiger, der die Menschen hasst. Mogli muss fliehen. Dorthin, wo Sicherheit und Verantwortung warten: zu Seinesgleichen, ins Menschendorf. Bagheera, der Panther, macht sich mit ihm auf den Weg; doch Mogli möchte bleiben, und als Balu, der Bär, ihm erklärt, dass mit Gemütlichkeit alles gut werde, erst recht.
Im Laufe der Geschichte kommen jedoch immer mehr Gefahren auf Mogli zu und wir erfahren: Für Shere Khan gibt es nichts, was er mehr fürchtet als das Feuer der Menschen: die «rote Blume». Am Ende ist es genau dieses Feuer, mit dem Mogli den mächtigen Tieger in die Flucht schlägt.
Doch halt – haben Sie es bemerkt? Ein winziger Fehler genügt, ein Tieger anstatt Tiger... und schon verliert der Herrscher des Dschungels seine Anmut. Genau so verändern Rechtschreibfehler den Eindruck des Textes. Selbst ein inhaltlich starker Aufsatz kann durch kleine Stolpersteine schwächer wirken.
Hand aufs Herz: Wissen Sie, warum man Tiger mit einfachen «i» schreibt, obwohl man es als langes «ie» spricht? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich haben Sie es irgendwann einfach auswendig gelernt. Vielleicht in einem jener Diktate, das damals knallrot zurückkam. Rechtschreibung ist nicht angeboren. Sie entsteht Schritt für Schritt: durch Übung, Wiederholen und Bewusstheit. Kein Kind im Dschungel wacht eines Tages auf und kann es einfach. Und genau hier beginnt die Frage, die mir so viele Eltern stellen:
Lernen Kinder Rechtschreibung heute noch zuverlässig?
Oft heisst es: «Das kommt schon noch.» Aber – wann eigentlich?
Hand aufs Herz: Wissen Sie, warum man Tiger mit einfachen «i» schreibt, obwohl man es als langes «ie» spricht? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich haben Sie es irgendwann einfach auswendig gelernt. Vielleicht in einem jener Diktate, das damals knallrot zurückkam. Rechtschreibung ist nicht angeboren. Sie entsteht Schritt für Schritt: durch Übung, Wiederholen und Bewusstheit. Kein Kind im Dschungel wacht eines Tages auf und kann es einfach. Und genau hier beginnt die Frage, die mir so viele Eltern stellen:
Lernen Kinder Rechtschreibung heute noch zuverlässig?
Oft heisst es: «Das kommt schon noch.» Aber – wann eigentlich?
Ein fehlender Buchstabe mit Folgen
Dass Rechtschreibung keine Nebensache ist, zeigt ein Fall aus Zürich, der viele bewegt hat. 2024 verpasste eine Schülerin die Gymiprüfung um winzige 0,07 Notenpunkte – und das aufgrund eines fehlenden Buchstabens. Sie sollte vom Nomen Gefahr das passende Verb ableiten. Sie wusste die richtige Lösung, schrieb aber gefärden ohne „h“. Der Inhalt stimmte, die Orthografie nicht … und das kostete genau jenen Punkt, der gefehlt hat.
Die Familie zog vor Gericht, doch das Verwaltungsgericht bestätigte: In Sprachprüfungen darf die Rechtschreibung bewertet werden, wenn die Aufgabenstellung es verlangt (nau.ch; Verwaltungsgericht Zürich).
Ein winziger Buchstabe, grosse Wirkung. Und ein Beispiel dafür, wie Orthografie zum Zünglein an der Waage werden kann.
Die Familie zog vor Gericht, doch das Verwaltungsgericht bestätigte: In Sprachprüfungen darf die Rechtschreibung bewertet werden, wenn die Aufgabenstellung es verlangt (nau.ch; Verwaltungsgericht Zürich).
Ein winziger Buchstabe, grosse Wirkung. Und ein Beispiel dafür, wie Orthografie zum Zünglein an der Waage werden kann.
Korrekturschema der ZAP: Wann zählen Rechtschreibfehler – und wann nicht?
Die zentrale Aufnahmeprüfung (ZAP) im Kanton Zürich besteht im Deutsch aus zwei Teilen: einem Aufsatz und einer Sprach- und Textverständnisprüfung. Letztere ist in einzelne Aufgaben unterteilt und je nach Aufgabentyp spielt die Orthografie eine unterschiedliche Rolle. Ein Blick in das Korrekturschema 2025 zeigt klar, wann Rechtschreibung Punkte kostet:
Kurz gesagt: Die ZAP unterscheidet sehr wohl, wo Rechtschreibung mitbewertet wird.
Beim Aufsatz fliesst die Orthografie ebenfalls in die Note ein, im 2025 wurden beispielsweise die Sprache (Wortwahl, Stil, Grammatik, Orthografie zusammen) zu 40% gewertet und der Inhalt zu 60%. Einzelne Rechtschreibfehler drücken dort also die Teilnote «Sprache».
In der Sprachprüfung hingegen greift je nach Aufgabe ein differenziertes System: Mal gibt es Toleranzgrenzen für Fehler, mal Nulltoleranz, mal völliges Desinteresse an der Rechtschreibung. Für die Prüflinge ist das eine gute Nachricht: Nicht jeder Buchstabendreher bedeutet sofort das Aus. Aber an den kritischen Stellen, vor allem dort, wo konkret sprachliche Kenntnisse abgefragt werden, muss die Rechtschreibung sitzen, sonst verschenkt man Punkte.
- Leseverständnis-Fragen (z. B. Aufgabe 3, 6, 8): hier müssen die Schüler:innen in eigenen Worten Antworten formulieren. Kleinere Rechtschreib- und Grammatikfehler werden toleriert. Erst wenn es zu viele werden, erfolgt ein Punktabzug. Konkret galt 2025 etwa: Bis zu 2–3 Fehler bleiben folgenlos, ab 3–4 Fehlern wird ein Punkt angezogen (zh.ch). Interpunktionsfehler (Zeichensetzung) bleiben sogar gänzlich ausser Acht. Die Devise lautet also: Inhalt vor Form, solange die Form nicht völlig aus dem Ruder läuft. Einschub meinerseits: Ich habe Mühe damit, dass im Textverständnisteil auch die Rechtschreibung mitgewichtet wird. Ich beobachte immer wieder Schüler:innen, welche ein unglaubliches Verständnis für Sprache, Inhalt und Symbolik haben, doch (aus was für Gründen auch immer) einfach eine schwache Rechtschreibung aufweisen. Ihnen hier beim Textverständnisteil die Rechtschreibung mitzubewerten, ist für mich persönlich nicht stimmig.
- Wortschatz- und Grammatikaufgaben (z.B. Aufgabe 11 und 13): In diesen Teilen müssen richtige Formen und Ableitungen gefunden werden. Zum Beispiel ein Verb und ein Adjektiv zur gegebenen Nominalform («Gefahr» –> «gefährden» – > «gefährlich»). Hier gibt es nur Punkte, wenn die Lösung exakt richtig geschrieben ist. Ein fehlender Buchstabe wie das h in unserem Eingangsbeispiel kann hier also den ganzen Punkt kosten.
- Sprachbetrachtung ohne Verschriftlichung (z.B. gewisse Grammatik- und Analyseaufgaben, Aufgabe 12 und 14): Bei Aufgaben, in denen die Schüler:innen z.B. Satzglieder unterstreichen, Satzumstellungen vornehmen oder ähnlich, steht die Analyseleistung im Vordergrund. Rechtschreibfehler werden nicht berücksichtigt (zh.ch), solange der Inhalt erkennbar ist. Hier soll keine:r an der Rechtschreibung scheitern, wenn es eigentlich um Grammatikverständnis geht. Wichtig ist aber, dass die Lösung leserlich bleibt. Unentzifferbare Krakel können natürlich indirekt doch zu Punktabzug führen, weil die Lösung dann nicht gewertet werden kann.
Kurz gesagt: Die ZAP unterscheidet sehr wohl, wo Rechtschreibung mitbewertet wird.
Beim Aufsatz fliesst die Orthografie ebenfalls in die Note ein, im 2025 wurden beispielsweise die Sprache (Wortwahl, Stil, Grammatik, Orthografie zusammen) zu 40% gewertet und der Inhalt zu 60%. Einzelne Rechtschreibfehler drücken dort also die Teilnote «Sprache».
In der Sprachprüfung hingegen greift je nach Aufgabe ein differenziertes System: Mal gibt es Toleranzgrenzen für Fehler, mal Nulltoleranz, mal völliges Desinteresse an der Rechtschreibung. Für die Prüflinge ist das eine gute Nachricht: Nicht jeder Buchstabendreher bedeutet sofort das Aus. Aber an den kritischen Stellen, vor allem dort, wo konkret sprachliche Kenntnisse abgefragt werden, muss die Rechtschreibung sitzen, sonst verschenkt man Punkte.
Schreiben Kinder heute schlechter?
Viele Eltern fragen sich besorgt: ist die Rechtschreibung unserer Kinder schlechter geworden als früher? Man hört ja oft, die Jugend könne kaum noch fehlerfrei schreiben, angeblich beeinflusst von Chats, Autokorrektur und neuen Lernmethoden. Aber stimmt das wirklich?
Was Studien zeigen
Die Forschung zeichnet ein gemischtes Bild. Historische Vergleiche aus Deutschland belegen einen Rückgang: Der Germanist Wolfgang Steinig fand in einer viel zitierten Studie, dass Viertklässler im Jahr 2012 fast doppelt so viele Fehler machten wie ihre Altersgenossen 40 Jahre zuvor. Und diese Studie ist notabene auch schon wieder 13 Jahre her. Auch deutsche Vergleichstests (IQB-Bildungstrends) bestätigen, dass ein signifikanter Teil der Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards in Orthografie verfehlte.
Gleichzeitig schreiben Kinder heute sprachlich kreativer und inhaltlich freier.
Gleichzeitig schreiben Kinder heute sprachlich kreativer und inhaltlich freier.
Die Lage in der Schweiz
Hier liegen aktuelle(re) Daten vor: Die Überprüfung der Grundkompetenz (ÜGK 2023) testete erstmals flächendeckend die Rechtschreibung im 11. Schuljahr. Ergebnis: Rund 84% der Jugendlichen in der Deutschschweiz erreichen die geforderten Mindest-standards. Zwischen den Kantonen gibt es Unterschiede, insgesamt liegt die Schweiz aber auf einem soliden Niveau. Eine klare Antwort auf die Frage «besser oder schlechter geworden?» gibt es jedoch noch nicht. Die ÜGK ist eine Momentaufnahme, keine Langzeitmessung. Erst mit den nächsten Erhebungen – geplant im Vierjahresrhythmus ab 2026 - lassen sich verlässliche Trends erkennen. Erste kantonale Auswertungen (z.B. in St. Gallen) deuten bei einzelnen Gruppen zwar auf leichte Rückgänge hin, für die ganze Schweiz gilt das aber noch nicht.
Fazit bis hierhin: Unsere Kinder schreiben heute anders. Kreativer, vielfältiger, manchmal fehlerhafter. Ob daraus ein langfristiger Abwärtstrend entsteht, wird erst die kommende Bildungsforschung zeigen.
Drei Knacknüsse unserer Zeit
- Weniger Lesen & Vorlesen: Kinder lesen weniger Bücher, Eltern lesen seltener vor. Dabei passiert gerade dort das «implizite Lernen», nämlich das unbewusste Einprägen korrekter Wortbilder.
- Digitalisierung & Kurznachrichten: Jugendliche schreiben ständig – aber in Chats. Dort herrschen Kleinschreibung, Abkürzungen und kreative Schreibweisen. Autokorrektur rettet vieles, ersetzt aber kein Lernen. Von Hand wird kaum noch geschrieben, doch auch dies würde das Einprägen der Wörter unterstützen.
- Methode & Lehrplan 21: Das viel diskutierte «Schreiben nach Gehör» funktioniert nur, wenn Lehrpersonen rechtzeitig zu klaren Rechtschreibregeln überleiten. Das zeigen Studien aus Deutschland (Deutsches Schulportal, 2021). Doch haben die Lehrpersonen wirklich noch Kapazität dafür?
Meine Sicht aus der Gymivorbereitung Zürich
Aus meiner Arbeit mit Hunderten von Schüler:innen sehe ich noch andere Gründe: Früher begleitete eine Lehrperson die Kinder in mehreren Fächern. Sie kannte sie gut und trug auch die Rechtschreibung quer durchs Jahr mit. Heute sind die Zuständigkeiten aufgeteilt, Zeitressourcen knapp, Pflichtenheft voll.
Der Lehrplan 21 ist in seiner Struktur hervorragend. Aber er verlangt viel: Lehrpersonen müssen Inhalte vermitteln, fördern, dokumentieren, individualisieren. Und dazwischen soll noch Raum bleiben, um Regeln zu erklären, sie zu üben, zu wiederholen und zu verankern. Und wer setzt diesen Lehrplan 21 um? Entweder junge Lehrpersonen, die anhand dessen studiert haben, nun aber oft gerne im Teilpensum arbeiten und so nicht 100% bei den Kids sind. Oder Lehrpersonen, welche den Lehrplan in ein paar wenigen Weiterbildungstagen vermittelt bekamen. Und das sind über 470 Seiten…
Meine persönliche Anmerkung: Ich halte den Lehrplan für ein sehr gutes Konzept. Aber er braucht in der Umsetzung Zeit, Systematik und Geduld - und genau das ist in vielen Schulstunden knapp.
In unseren Kursen bei der Gymivorbereitung Zürich sehen wir, wie stark Kinder profitieren, wenn sie konsequent, spielerisch und regelmässig an ihren Lernwörtern arbeiten.
Rechtschreibung ist lernbar – wirklich.
Der Lehrplan 21 ist in seiner Struktur hervorragend. Aber er verlangt viel: Lehrpersonen müssen Inhalte vermitteln, fördern, dokumentieren, individualisieren. Und dazwischen soll noch Raum bleiben, um Regeln zu erklären, sie zu üben, zu wiederholen und zu verankern. Und wer setzt diesen Lehrplan 21 um? Entweder junge Lehrpersonen, die anhand dessen studiert haben, nun aber oft gerne im Teilpensum arbeiten und so nicht 100% bei den Kids sind. Oder Lehrpersonen, welche den Lehrplan in ein paar wenigen Weiterbildungstagen vermittelt bekamen. Und das sind über 470 Seiten…
Meine persönliche Anmerkung: Ich halte den Lehrplan für ein sehr gutes Konzept. Aber er braucht in der Umsetzung Zeit, Systematik und Geduld - und genau das ist in vielen Schulstunden knapp.
In unseren Kursen bei der Gymivorbereitung Zürich sehen wir, wie stark Kinder profitieren, wenn sie konsequent, spielerisch und regelmässig an ihren Lernwörtern arbeiten.
Rechtschreibung ist lernbar – wirklich.
Wenn Fehler den Gesamteindruck prägen
Warum legen wir überhaupt so viel Wert auf Rechtschreibung? Weil Fehler nicht nur den Lesefluss stören, sondern auch das Bild verzerren.
Psychologisch nennt man das den Halo-Effekt: Ein Merkmal, in diesem Fall ein Fehler, färbt das Gesamturteil. Ein Text mit vielen Rechtschreibfehlern wirkt automatisch weniger kompetent, selbst wenn der Inhalt stark ist.
Studien zeigen das seit Jahrzehnten: Schon Rudolf Weiss (1965) und später Birkel & Birkel (2002) wiesen nach, dass Aufsatzbewertungen strenger ausfallen, wenn die Orthografie schwach ist. Neuere Untersuchungen (IR FHNW) bestätigen: Ein schwacher Wortschatz oder viele Schreibfehler senken auch die Bewertungen für Grammatik und Aufbau, obwohl diese objektiv gleich bleiben.
Und ganz offen: Wir alle kennen es. Ein Elternbrief mit Tippfehlern, eine Bewerbung mit Schreibfehlern – schon wirkt sie weniger sorgfältig oder gar weniger professionell. Fehler lösen unbewusst Skepsis aus.
Darum ist Rechtschreibung auch eine Art Visitenkarte. Sie steht für Genauigkeit, Konzentration und letztlich auch für Haltung.
Oder, mit einem Augenzwinkern formuliert: Ein Tiger wirkt einfach stärker als ein Tieger.
Psychologisch nennt man das den Halo-Effekt: Ein Merkmal, in diesem Fall ein Fehler, färbt das Gesamturteil. Ein Text mit vielen Rechtschreibfehlern wirkt automatisch weniger kompetent, selbst wenn der Inhalt stark ist.
Studien zeigen das seit Jahrzehnten: Schon Rudolf Weiss (1965) und später Birkel & Birkel (2002) wiesen nach, dass Aufsatzbewertungen strenger ausfallen, wenn die Orthografie schwach ist. Neuere Untersuchungen (IR FHNW) bestätigen: Ein schwacher Wortschatz oder viele Schreibfehler senken auch die Bewertungen für Grammatik und Aufbau, obwohl diese objektiv gleich bleiben.
Und ganz offen: Wir alle kennen es. Ein Elternbrief mit Tippfehlern, eine Bewerbung mit Schreibfehlern – schon wirkt sie weniger sorgfältig oder gar weniger professionell. Fehler lösen unbewusst Skepsis aus.
Darum ist Rechtschreibung auch eine Art Visitenkarte. Sie steht für Genauigkeit, Konzentration und letztlich auch für Haltung.
Oder, mit einem Augenzwinkern formuliert: Ein Tiger wirkt einfach stärker als ein Tieger.
Shere Khan und das Feuer des Lernens
Im Dschungelbuch fürchtet Shere Khan das Feuer, die rote Blume, wie sie dort genannt wird. Mogli siegt, weil er sich dies zu eigen macht.
Auch beim Lernen gilt: Wer das Feuer des Könnens in sich trägt, fürchtet den Tiger «Gymiprüfung» nicht.
Wenn Kinder merken: Ich habe die Worte im Griff, nicht sie mich, wächst Selbstvertrauen. Jede richtig geschriebene Endung, jedes verstandene Prinzip ist wie ein Funke in dieser Flamme.
Damit dieses Feuer brennt, brauchen Kinder keine Angst vor Fehlern (oder gar deren Konsequenzen), sondern Eltern, die sagen: «Fehler zeigen, dass du gerade lernst.»
Ein Growth Mindset hilft: Fähigkeiten sind nichts Festes. Sie wachsen mit Übung, Geduld und Rückhalt. Loben Sie nicht nur das Resultat, sondern den Weg dorthin: «Du hast dir eine gute Methode überlegt. Das zeigt, dass du dranbleibst.» So entsteht Motivation, die von innen kommt.
Denn das wahre Feuer, das Shere Khan vertreibt, ist das Vertrauen: Ich kann lernen.
Auch beim Lernen gilt: Wer das Feuer des Könnens in sich trägt, fürchtet den Tiger «Gymiprüfung» nicht.
Wenn Kinder merken: Ich habe die Worte im Griff, nicht sie mich, wächst Selbstvertrauen. Jede richtig geschriebene Endung, jedes verstandene Prinzip ist wie ein Funke in dieser Flamme.
Damit dieses Feuer brennt, brauchen Kinder keine Angst vor Fehlern (oder gar deren Konsequenzen), sondern Eltern, die sagen: «Fehler zeigen, dass du gerade lernst.»
Ein Growth Mindset hilft: Fähigkeiten sind nichts Festes. Sie wachsen mit Übung, Geduld und Rückhalt. Loben Sie nicht nur das Resultat, sondern den Weg dorthin: «Du hast dir eine gute Methode überlegt. Das zeigt, dass du dranbleibst.» So entsteht Motivation, die von innen kommt.
Denn das wahre Feuer, das Shere Khan vertreibt, ist das Vertrauen: Ich kann lernen.
Die Rolle der Eltern: zwischen Balu und Bagheera
Wenn man das Dschungelbuch genau betrachtet, erkennt man in Balu und Bagheera zwei sehr unterschiedliche Begleiter.
Balu, der gemütliche Bär, glaubt an das Lernen durch Leichtigkeit. Er summt, lacht, traut Mogli etwas zu und lässt ihn seine Erfahrungen machen. Denn durch Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir.
Bagheera, der schwarze Panther, ist klug, vorausschauend und sorgt sich. Er will Mogli beschützen, ihn auf dem sicheren Weg halten. Manchmal etwas streng, aber aus Liebe.
Beide haben recht.
Und doch verlieren sie Mogli irgendwann aus den Augen. Mogli verirrt sich, gerät in Schwierigkeiten, findet aber auch seinen Mut. Und am Ende, als der Tiger besiegt ist, steht er am Fluss, gemeinsam mit Balu und Bagheera. Er könnte im Dschungel bleiben. Doch dann sieht er ein Mädchen – und geht mit ihr ins Dorf.
Er entscheidet für sich selbst. Und Balu und Bagheera müssen ihn gehen lassen.
Vielleicht ist das genau das Bild für uns Eltern:
Wir dürfen beschützen und fordern, trösten und loslassen.
Wir können zeigen, wie man lernt, aber den Weg gehen müssen die Kinder selbst.
Ob das Wort nun mit ie oder nur mit i geschrieben wird – am Ende zählt nicht die perfekte Rechtschreibung, sondern die Haltung, mit der man lernt.
Rechtschreibung darf nicht zur Bedrohung werden, die Beziehung nicht zum Prüfungsfeld. Es gibt kein richtig oder falsch im Begleiten. Es gibt nur Prozesse, das Dabeisein und das Vertrauen, dass das Kind seinen Weg finden wird.
Balu, der gemütliche Bär, glaubt an das Lernen durch Leichtigkeit. Er summt, lacht, traut Mogli etwas zu und lässt ihn seine Erfahrungen machen. Denn durch Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir.
Bagheera, der schwarze Panther, ist klug, vorausschauend und sorgt sich. Er will Mogli beschützen, ihn auf dem sicheren Weg halten. Manchmal etwas streng, aber aus Liebe.
Beide haben recht.
Und doch verlieren sie Mogli irgendwann aus den Augen. Mogli verirrt sich, gerät in Schwierigkeiten, findet aber auch seinen Mut. Und am Ende, als der Tiger besiegt ist, steht er am Fluss, gemeinsam mit Balu und Bagheera. Er könnte im Dschungel bleiben. Doch dann sieht er ein Mädchen – und geht mit ihr ins Dorf.
Er entscheidet für sich selbst. Und Balu und Bagheera müssen ihn gehen lassen.
Vielleicht ist das genau das Bild für uns Eltern:
Wir dürfen beschützen und fordern, trösten und loslassen.
Wir können zeigen, wie man lernt, aber den Weg gehen müssen die Kinder selbst.
Ob das Wort nun mit ie oder nur mit i geschrieben wird – am Ende zählt nicht die perfekte Rechtschreibung, sondern die Haltung, mit der man lernt.
Rechtschreibung darf nicht zur Bedrohung werden, die Beziehung nicht zum Prüfungsfeld. Es gibt kein richtig oder falsch im Begleiten. Es gibt nur Prozesse, das Dabeisein und das Vertrauen, dass das Kind seinen Weg finden wird.
Fünf Sätze, mit denen Sie Ihr Kind unterstützen
“
- «Mega guter Fehler! Schau mal, was man daran jetzt alles lernen kann!»
- «Wer keine Fehler macht, macht auch sonst nicht viel.»
- «Aus Fehlern wird man klug – deshalb ist einer nicht genug.»
- «Wir geben alles. Nur nicht auf!»
- «Wie wäre es, wenn wir es heute mal ganz anders machen?»
Methoden zum gezielten Üben
der Rechtschreibung
(für Kinder & Jugendliche 10–15 Jahre)
der Rechtschreibung
(für Kinder & Jugendliche 10–15 Jahre)
Rechtschreibkompetenz ist keine angeborene Fähigkeit, sondern entsteht durch das Zusammenspiel von phonologischen und visuellen Fertigkeiten, Wortschatz, Regelwissen und Motivation. Die Folgenden zehn Methoden kombinieren bewährte Strategien mit neuen, praxisnahen Ansätzen.
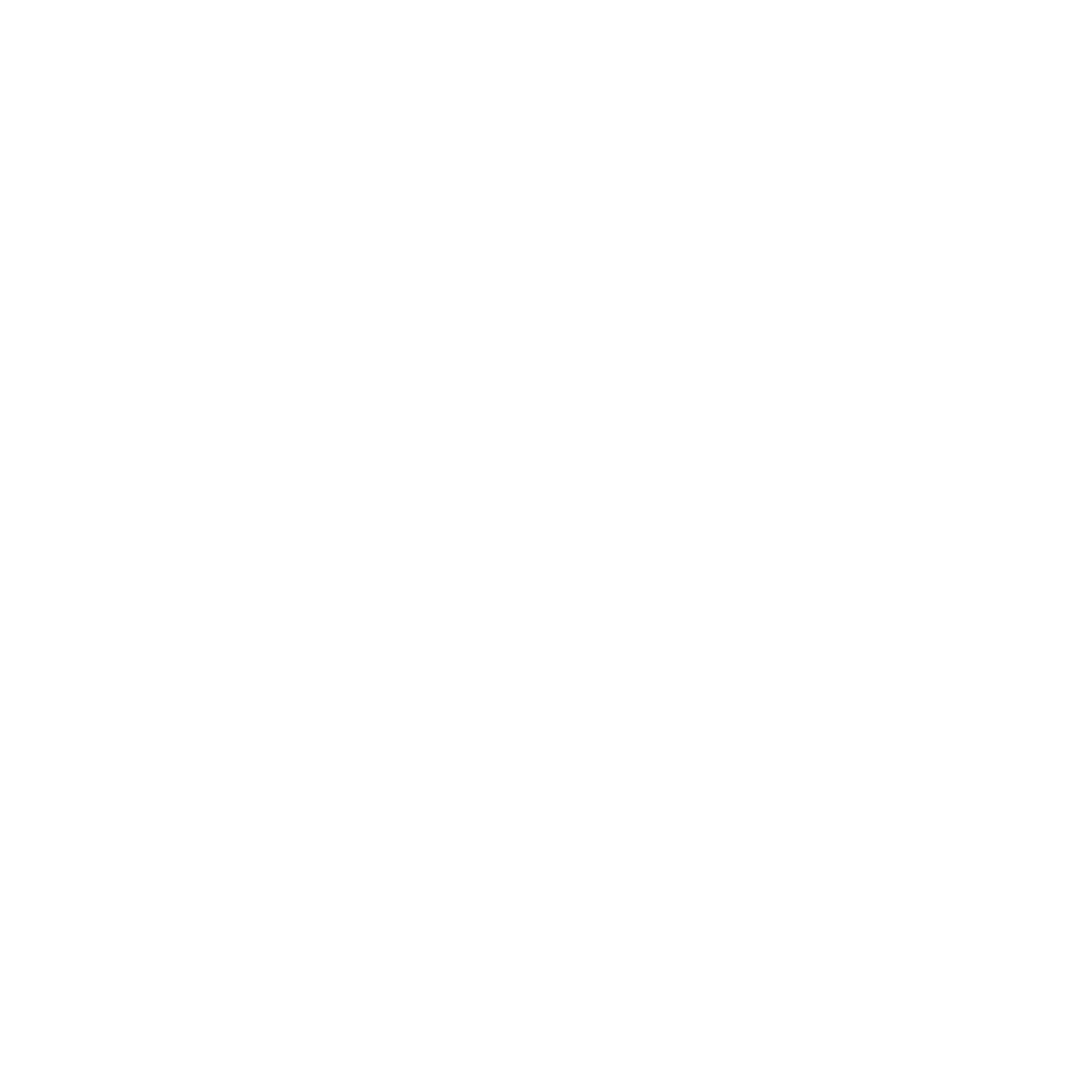
1.
Persönliche Lernwort-Liste & Fehleranalyse
Viele Kinder profitieren von individuellen Wortlisten, die aus ihren eigenen Fehlern entstehen. Jedes Kind führt eine persönliche Liste mit schwierigen Wörtern und wiederholt diese regelmässig. Der Karteikasten nach Sebastian Leitner bleibt ein Klassiker, digital oder analog, wobei ich analog klar bevorzuge. Karten werden so lange wiederholt, bis sie fehlerfrei geschrieben werden; danach wandern sie in ein weiter hinten liegendes Fach und werden seltener abgefragt. Wird das Wort wieder falsch geschrieben, geht es zurück an den Anfang. Hier ein Video, welches dieses Vorgehen erklärt.
Tipp: Eltern können unterstützen, indem sie die Karten regelmässig auf Richtigkeit kontrollieren.
Viele Kinder profitieren von individuellen Wortlisten, die aus ihren eigenen Fehlern entstehen. Jedes Kind führt eine persönliche Liste mit schwierigen Wörtern und wiederholt diese regelmässig. Der Karteikasten nach Sebastian Leitner bleibt ein Klassiker, digital oder analog, wobei ich analog klar bevorzuge. Karten werden so lange wiederholt, bis sie fehlerfrei geschrieben werden; danach wandern sie in ein weiter hinten liegendes Fach und werden seltener abgefragt. Wird das Wort wieder falsch geschrieben, geht es zurück an den Anfang. Hier ein Video, welches dieses Vorgehen erklärt.
Tipp: Eltern können unterstützen, indem sie die Karten regelmässig auf Richtigkeit kontrollieren.
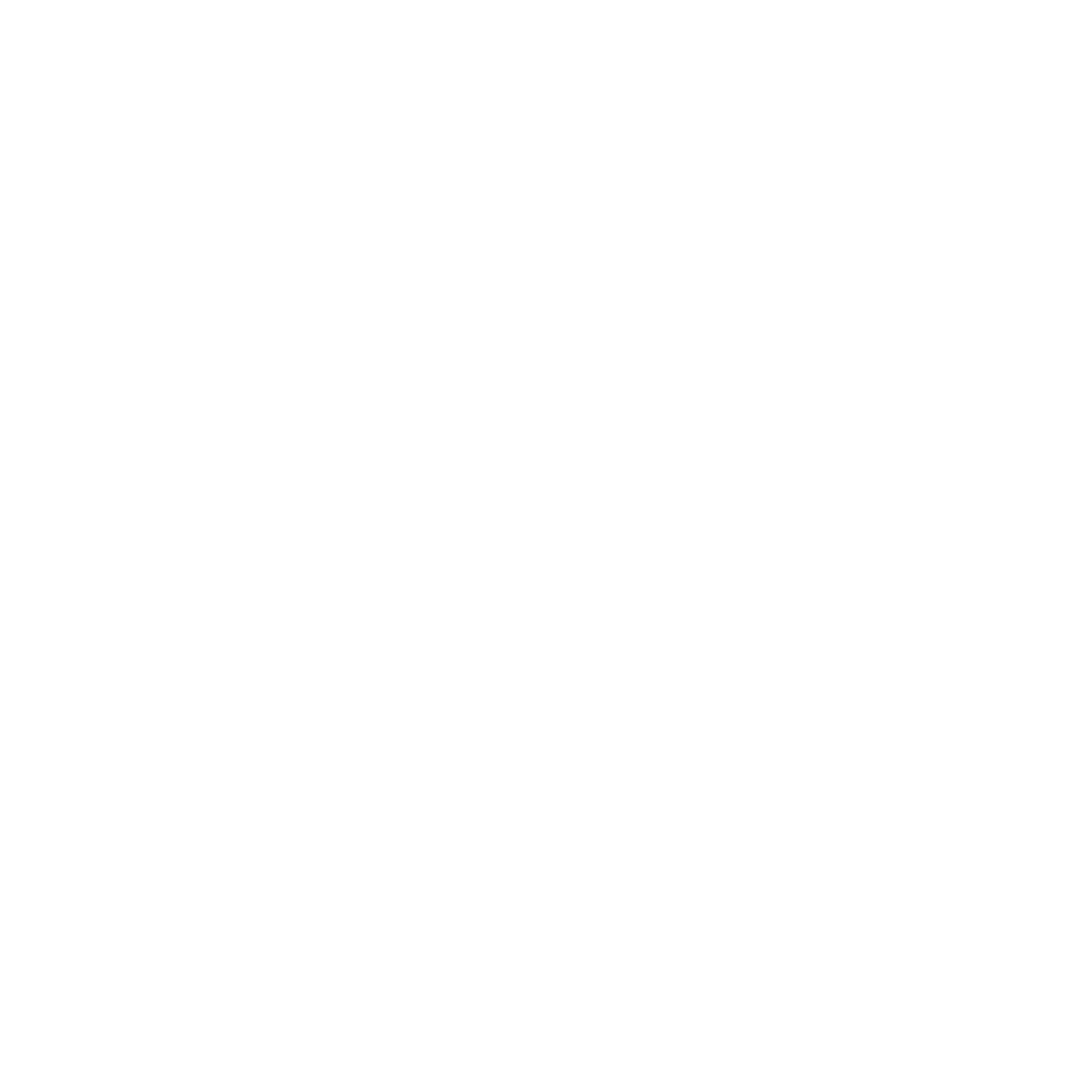
2.
Lernort wechseln
Immer am gleichen Tisch zu lernen, macht müde. Neue Orte aktivieren das Gehirn und helfen, Wörter besser zu behalten.
Immer am gleichen Tisch zu lernen, macht müde. Neue Orte aktivieren das Gehirn und helfen, Wörter besser zu behalten.
- In der Badewanne: Warm und ruhig – ideal zum Wiederholen. Mit einem Whiteboard-Marker kann man die Lernwörter auf die Fliesen schreiben. Geht übrigens auch ohne Wasser, sondern mit Kuscheldecke und Kissen.
- Im Lernzelt: Ein kleiner Rückzugsort schafft Fokus. Im Zelt oder unter einer Decke ist es still, sicher und gemütlich. Perfekt für Kinder, die leicht abgelenkt sind.
- Im Tram: Bewegung fördert Denken! Und so spannende Szenenwechsel aktivieren. Vielleicht könnte man pro Haltestelle ein besonders schwieriges Lernwort „ablegen“?
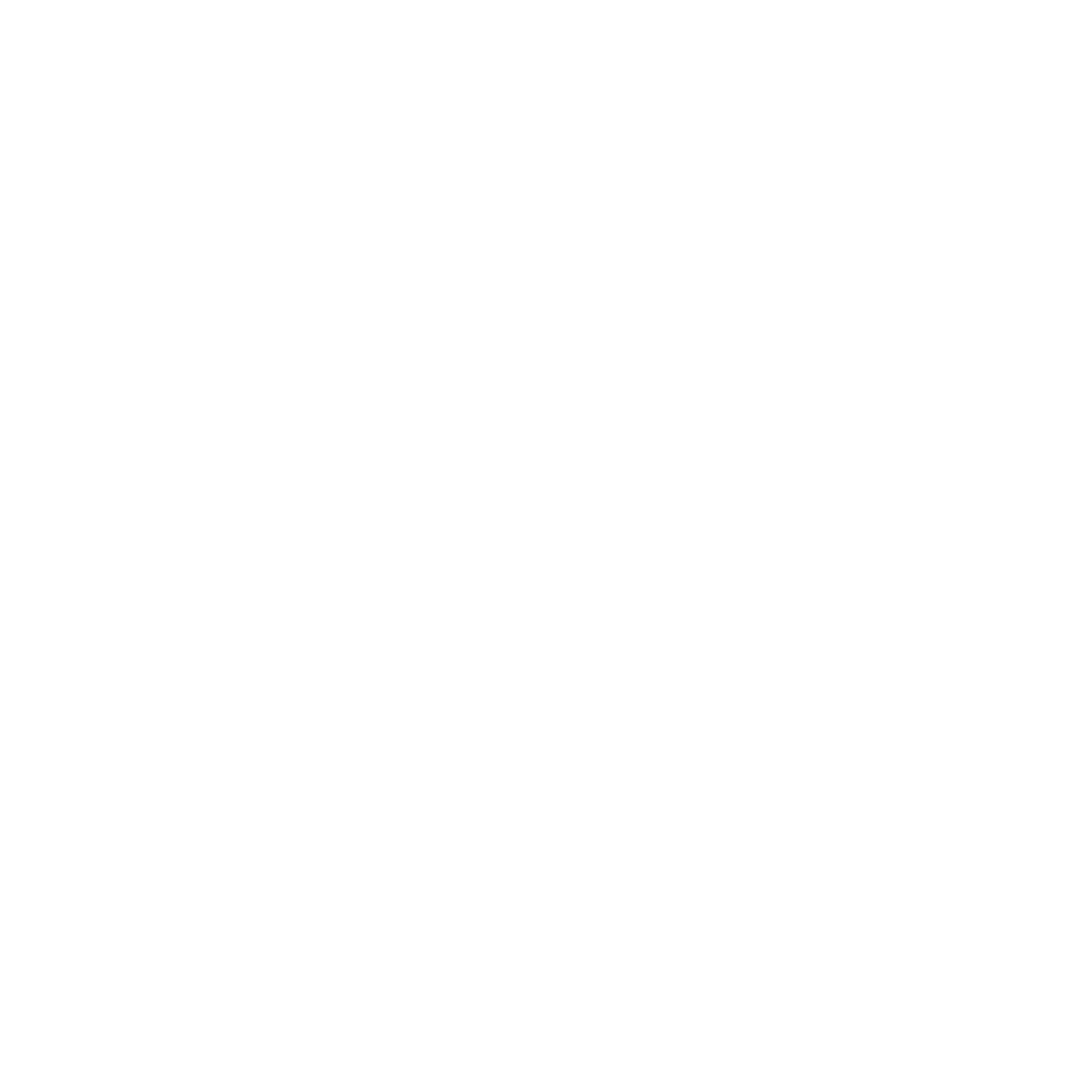
3.
Rechtschreibregeln verstehen und anwenden
Orthografie folgt Regeln und wer sie versteht, schreibt sicherer. Beispiele: das Doppelkonsonanten-Prinzip («ck», «tz» nach kurzem Vokal), das Stammprinzip («läuten» von »laut») oder die Unterscheidung «das/dass». Regeln sollten nicht auswendig gelernt werden, sondern aktiv angewendet werden, z.B. durch Mini-Diktate, Lückentexte oder Wortbaustein-Übungen. Fehler zeigen, welche Regel noch nicht sitzt und sind darum wertvolle Lernhelfer.
Orthografie folgt Regeln und wer sie versteht, schreibt sicherer. Beispiele: das Doppelkonsonanten-Prinzip («ck», «tz» nach kurzem Vokal), das Stammprinzip («läuten» von »laut») oder die Unterscheidung «das/dass». Regeln sollten nicht auswendig gelernt werden, sondern aktiv angewendet werden, z.B. durch Mini-Diktate, Lückentexte oder Wortbaustein-Übungen. Fehler zeigen, welche Regel noch nicht sitzt und sind darum wertvolle Lernhelfer.
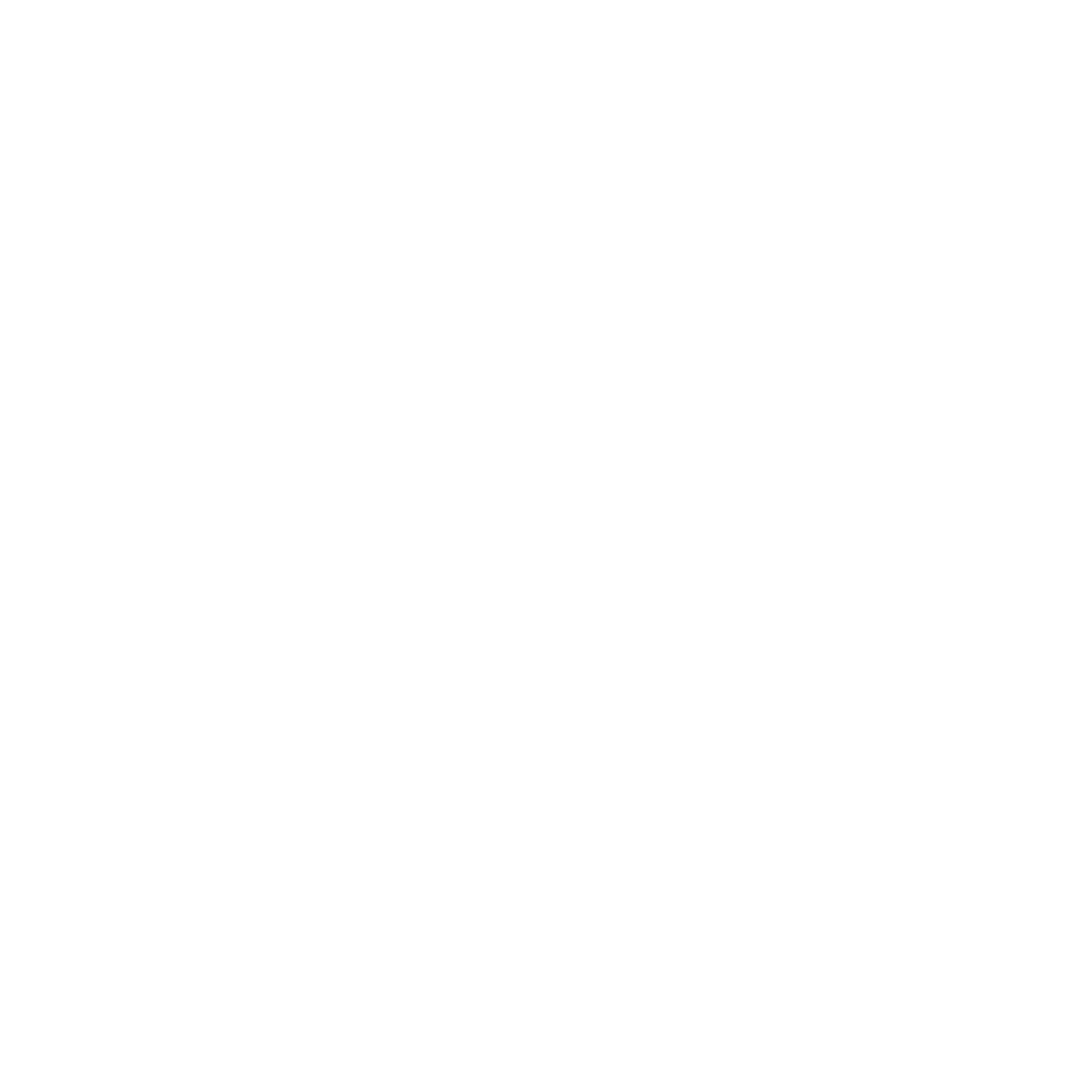
4.
Kurze, regelmässige Einheiten (Bedeutung kleiner Schritte)
Tägliche fünf Minuten sind effektiver als lange Übungsblöcke. Lerntherapeutin Dina Beneken betont: Kinder sollen dranbleiben, aber mit klarer Zeitbegrenzung und abwechslungsreichen Übungen. Stellen wir uns eine Leiter vor: mit kleinen «Zwischenstufen» kommt man schlussendlich sicherer ans Ziel. Eine grosse Aufgabe wird in kleine, machbare Schritte geteilt. Das reduziert Stress und schafft schnelle Erfolgserlebnisse. Eine klassische Eieruhr hilft, die Zeit im Blick zu behalten.
Tägliche fünf Minuten sind effektiver als lange Übungsblöcke. Lerntherapeutin Dina Beneken betont: Kinder sollen dranbleiben, aber mit klarer Zeitbegrenzung und abwechslungsreichen Übungen. Stellen wir uns eine Leiter vor: mit kleinen «Zwischenstufen» kommt man schlussendlich sicherer ans Ziel. Eine grosse Aufgabe wird in kleine, machbare Schritte geteilt. Das reduziert Stress und schafft schnelle Erfolgserlebnisse. Eine klassische Eieruhr hilft, die Zeit im Blick zu behalten.
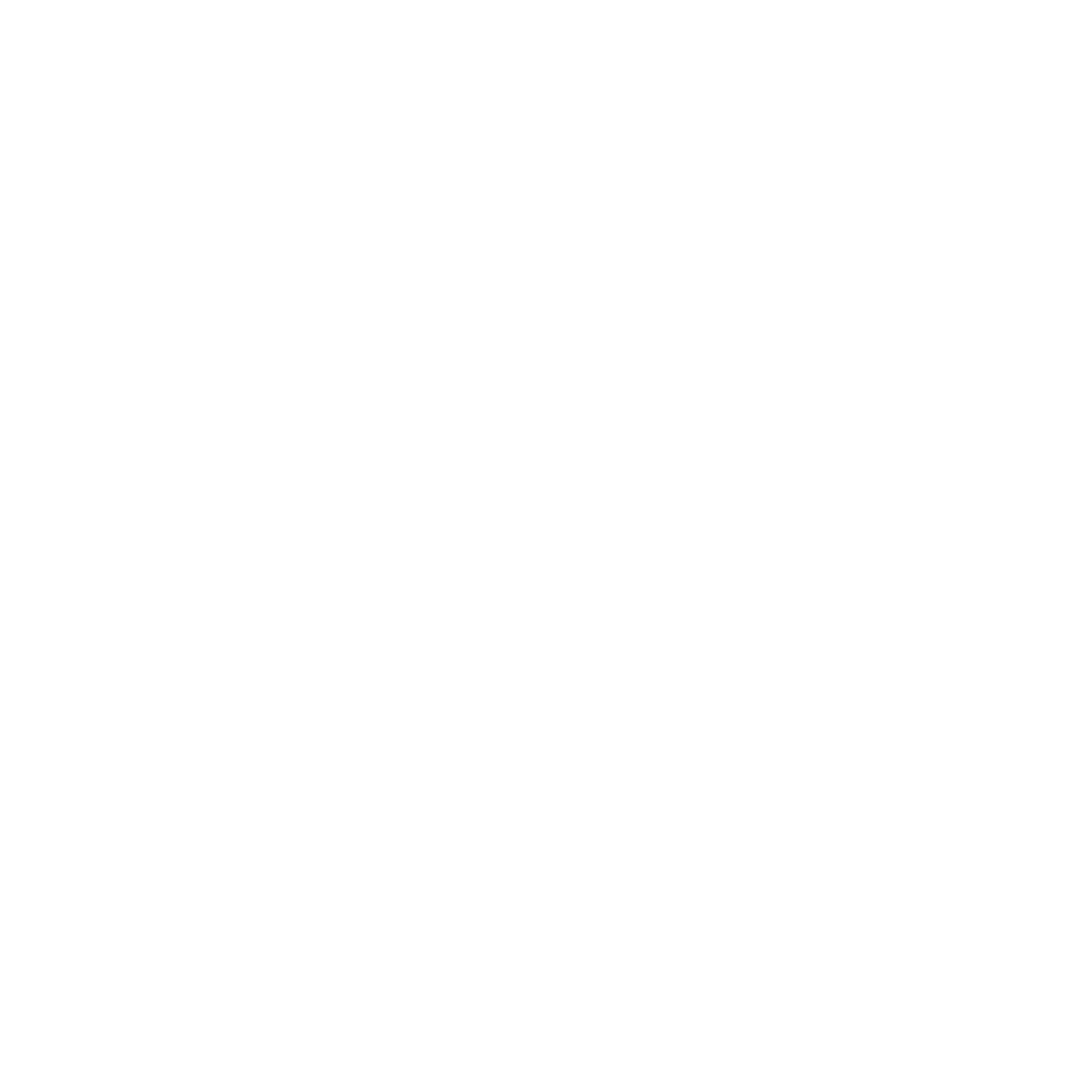
5.
Handschrift & Wortbild-Training
Handschrift verankert Wörter stärker als Tippen, weil mehrere Sinne beteiligt sind. Beim Wortbildtraining werden Wörter gross, bunt und mit Markierungen der Stolperstellen geschrieben. Gerne auch mit kleineren Zeichnungen. So prägt sich das Wortbild besser ein. Empfohlen wird, dass Kinder Wörter beim Schreiben in Silben sprechen und mit dem Stift «mitgehen», das stärkt wiederum die Verbindung zwischen Hören und Schreiben.
Handschrift verankert Wörter stärker als Tippen, weil mehrere Sinne beteiligt sind. Beim Wortbildtraining werden Wörter gross, bunt und mit Markierungen der Stolperstellen geschrieben. Gerne auch mit kleineren Zeichnungen. So prägt sich das Wortbild besser ein. Empfohlen wird, dass Kinder Wörter beim Schreiben in Silben sprechen und mit dem Stift «mitgehen», das stärkt wiederum die Verbindung zwischen Hören und Schreiben.
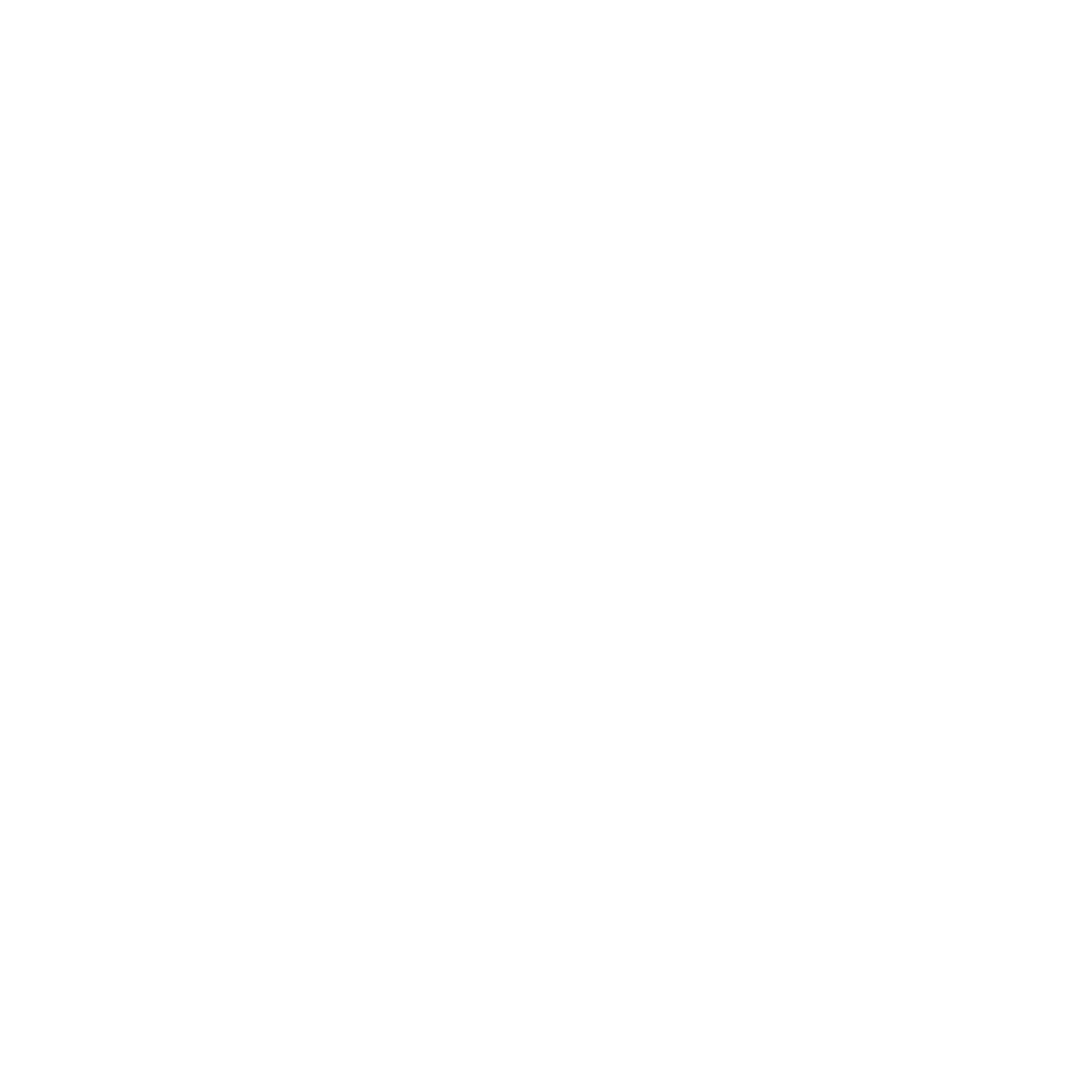
6.
Kreative Diktatformen
Ein Diktat muss nicht langweilig sein. Wanderdiktate (Sätze an der Wand lesen, merken, schreiben) oder Wettlauf-Diktate (Wörter im Raum verteilt sammeln) verbinden Bewegung und Schreiben. Körperliche Aktivität verbessert die kognitive Aufnahmefähigkeit. Quatsch-Diktate mit lustigen, selbst erfundenen Sätzen oder gar Geschichten steigern Motivation und Aufmerksamkeit.
Ein Diktat muss nicht langweilig sein. Wanderdiktate (Sätze an der Wand lesen, merken, schreiben) oder Wettlauf-Diktate (Wörter im Raum verteilt sammeln) verbinden Bewegung und Schreiben. Körperliche Aktivität verbessert die kognitive Aufnahmefähigkeit. Quatsch-Diktate mit lustigen, selbst erfundenen Sätzen oder gar Geschichten steigern Motivation und Aufmerksamkeit.
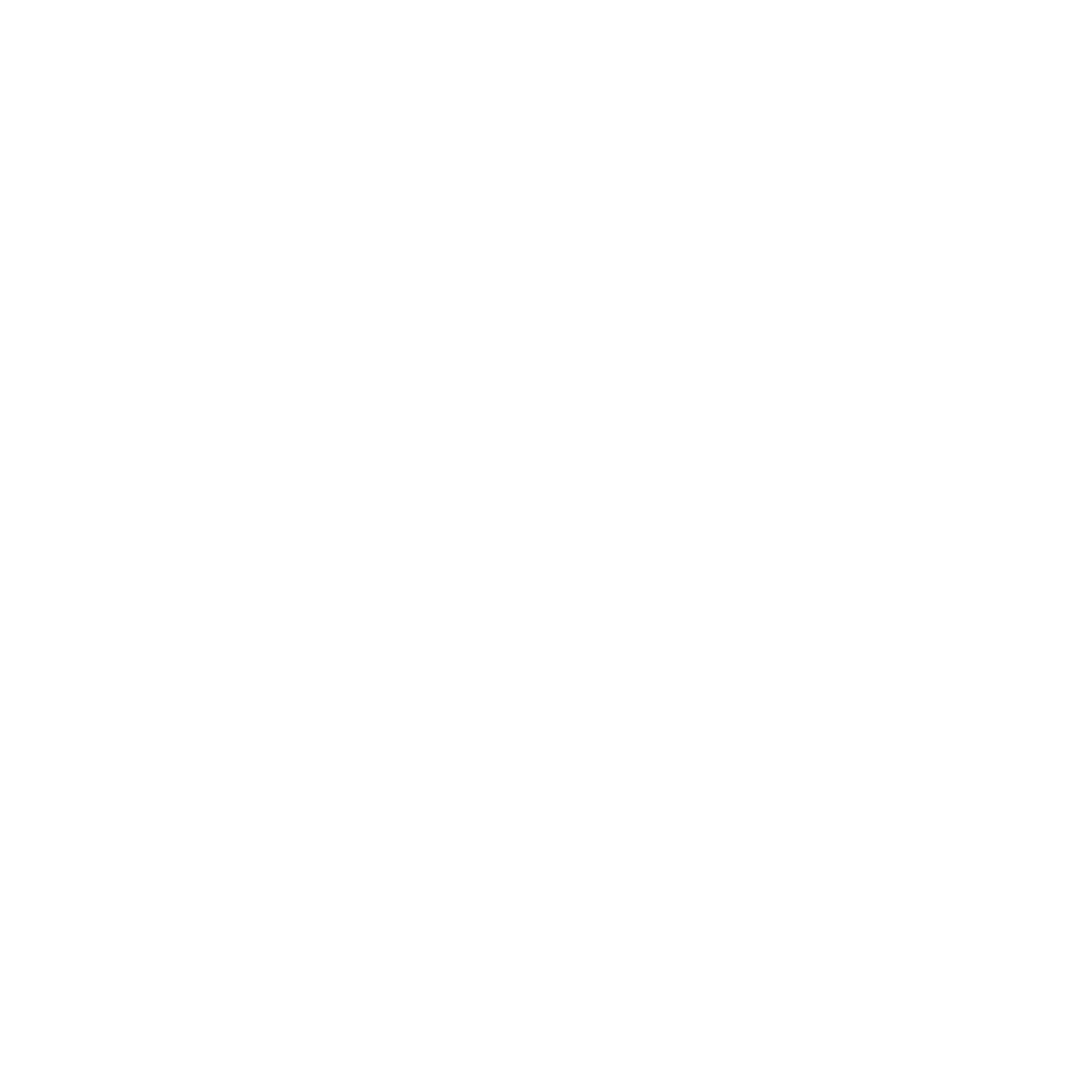
7.
Spielerisch lernen
Lernen funktioniert am besten, wenn das Gehirn aktiv, emotional und neugierig ist. Spielelemente bringen Spannung, kleine Erfolgserlebnisse und Spass ins Lernen. Der spielerische Wettbewerb setzt Dopamin frei und das Gelernte bleibt besser haften.
Lernen funktioniert am besten, wenn das Gehirn aktiv, emotional und neugierig ist. Spielelemente bringen Spannung, kleine Erfolgserlebnisse und Spass ins Lernen. Der spielerische Wettbewerb setzt Dopamin frei und das Gelernte bleibt besser haften.
- Beispiel 1: Lernwörter Memory: Ein richtig geschriebenes und ein falsch geschriebenes Wort bilden ein Paar. Wer das Richtige findet, darf es behalten – das trainiert genaue Wortwahrnehmung.
- Beispiel 2: Wörter Domino: Karten zeigen Silben oder Wortteile. Passende Teile werden zusammengesetzt. So entsteht ein Wort und die Struktur wird visuell verankert.
- Beispiel 3: Rechtschreib-Bingo: Auf dem Bingo-Feld stehen Lernwörter. Wird ein Wort vorgelesen, darf es abgedeckt werden. Aber nur, wenn es richtig geschrieben wird! Das sorgt für Konzentration und Motivation.
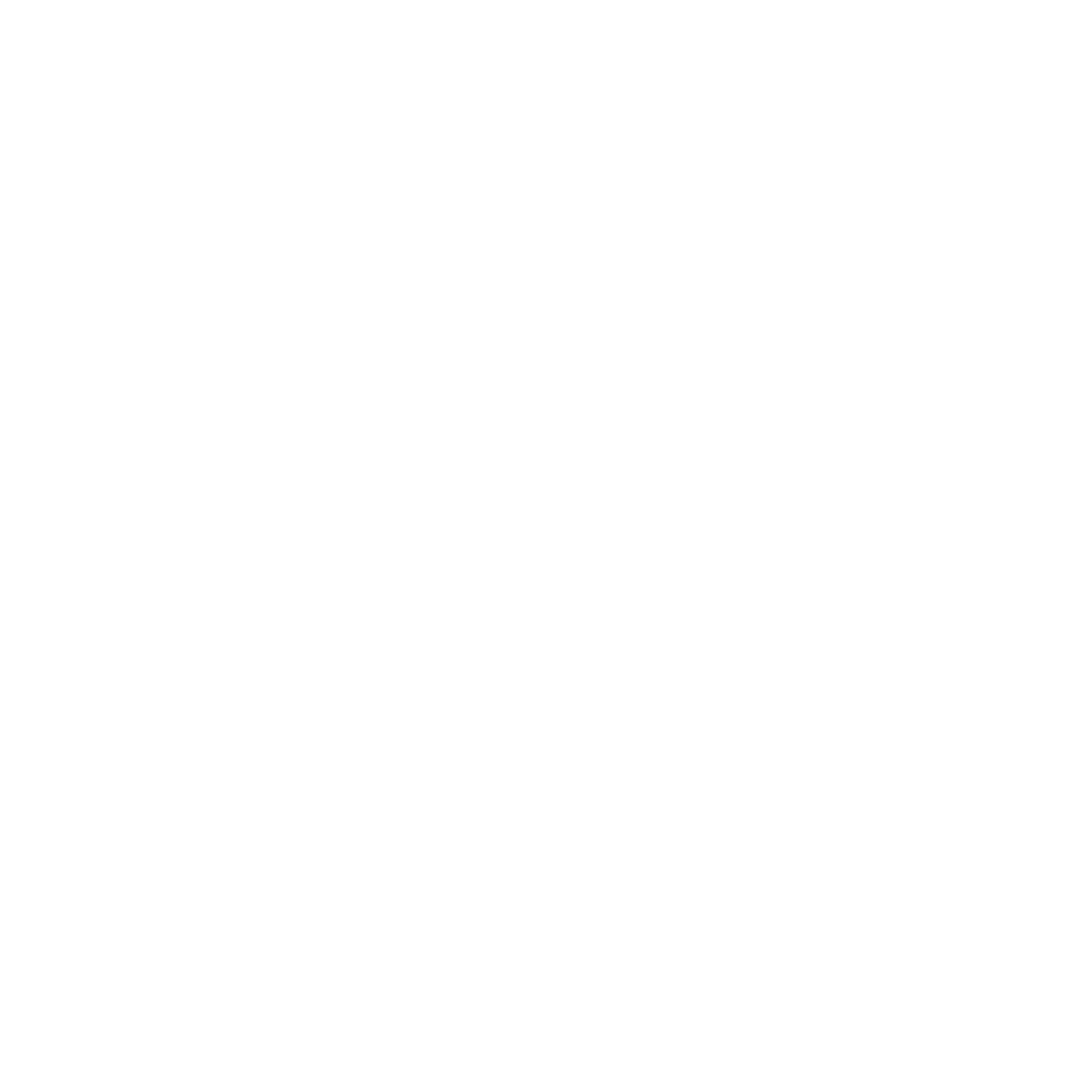
8.
Leseförderung durch simultanes Lesen
Eine sichere Rechtschreibung entsteht nicht nur durch Regelwissen, sondern durch Sprachgefühl und das wächst vor allem beim Lesen. Besonders wirksam ist das simultane Lesen und Hören: Kinder hören ein Hörbuch und lesen gleichzeitig mit. So sehen und hören sie korrekte Wortbilder, Satzmelodien und Betonungen. Noch schöner: gemeinsam lesen! Eltern und Kinder können sich beim Vorlesen auch abwechseln. Das schafft emotionale Verbindung und stärkt Motivation und Wortschatz ganz ohne Druck.
Eine sichere Rechtschreibung entsteht nicht nur durch Regelwissen, sondern durch Sprachgefühl und das wächst vor allem beim Lesen. Besonders wirksam ist das simultane Lesen und Hören: Kinder hören ein Hörbuch und lesen gleichzeitig mit. So sehen und hören sie korrekte Wortbilder, Satzmelodien und Betonungen. Noch schöner: gemeinsam lesen! Eltern und Kinder können sich beim Vorlesen auch abwechseln. Das schafft emotionale Verbindung und stärkt Motivation und Wortschatz ganz ohne Druck.
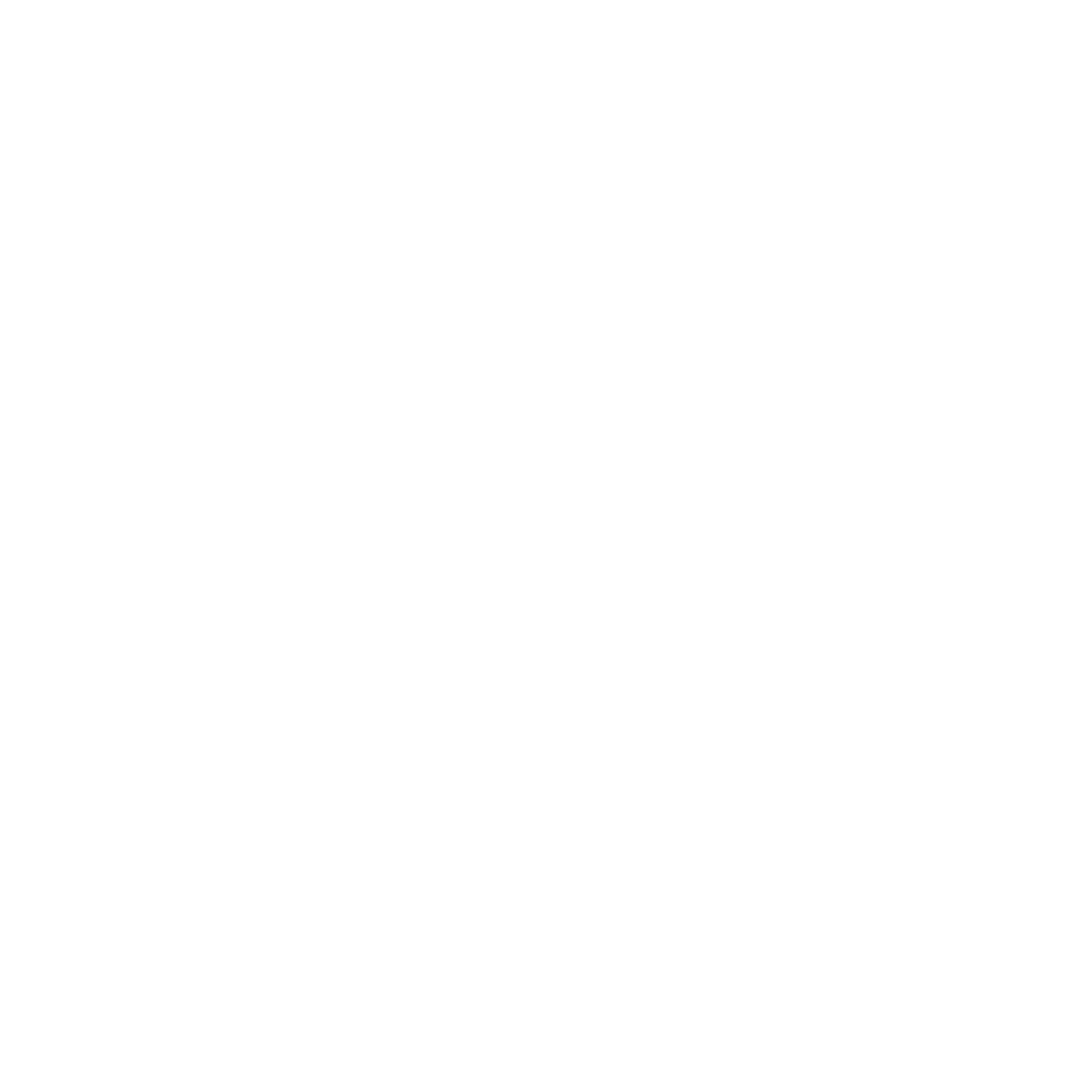
9.
Wörterbuchtraining
Das Nachschlagen unbekannter Wörter ist eine Kernkompetenz und darf geübt werden. An der Zürcher Gymiprüfung dürfen Schüler:innen im Aufsatzteil sogar einen Duden benutzen. Zuhause kann man spielerisch trainieren: Wer findet schneller «Tiger» im Duden? Wird ein falsches Wort entdeckt, wird es gemeinsam nachgeschlagen und eingeordnet. Das stärkt Suchstrategien und gibt Sicherheit.
Das Nachschlagen unbekannter Wörter ist eine Kernkompetenz und darf geübt werden. An der Zürcher Gymiprüfung dürfen Schüler:innen im Aufsatzteil sogar einen Duden benutzen. Zuhause kann man spielerisch trainieren: Wer findet schneller «Tiger» im Duden? Wird ein falsches Wort entdeckt, wird es gemeinsam nachgeschlagen und eingeordnet. Das stärkt Suchstrategien und gibt Sicherheit.
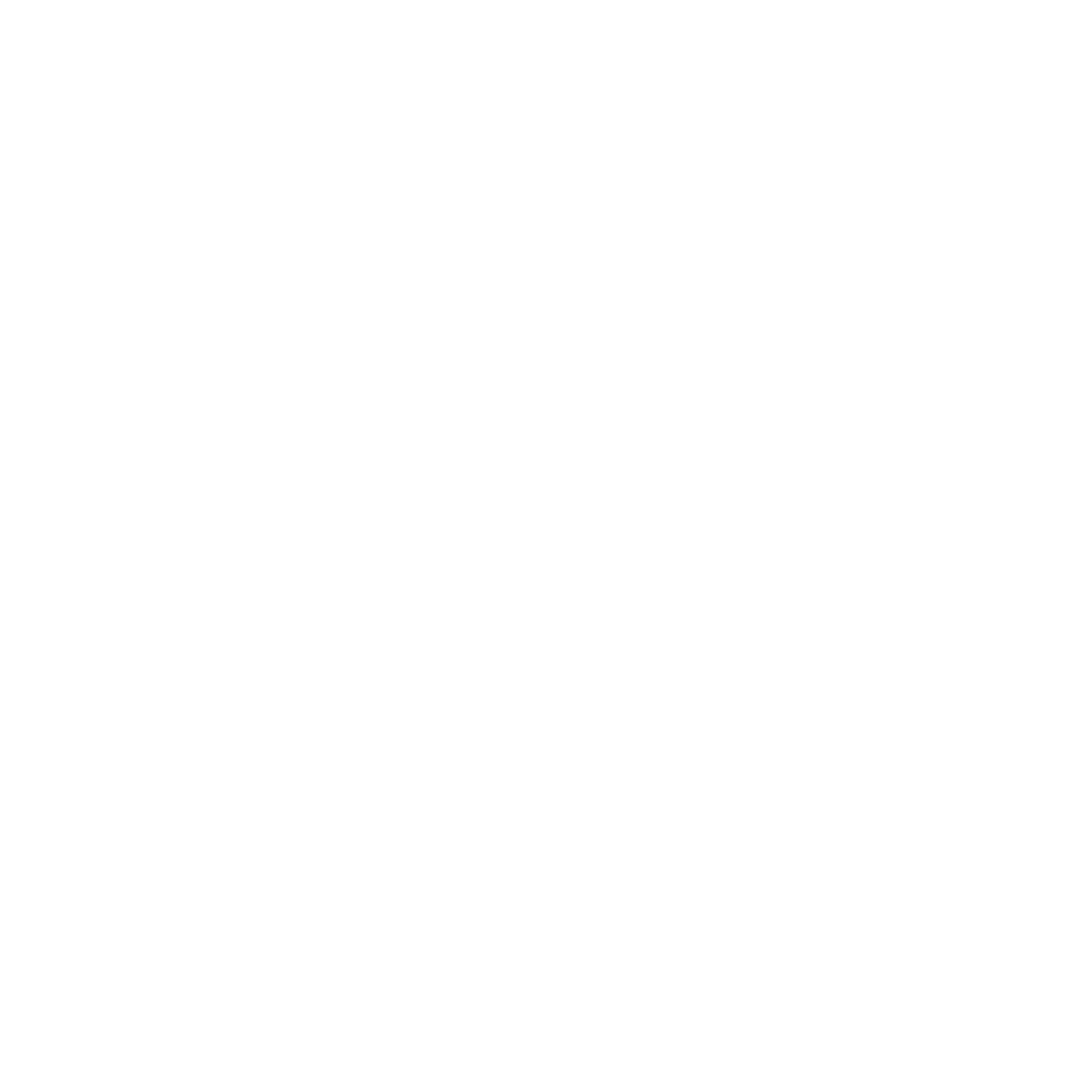
10.
Multisensorisch Lernen
Rechtschreibung bleibt besser hängen, wenn mehrere Sinne gleichzeitig aktiv sind. Je mehr Sinneskanäle beteiligt sind, desto stabiler die Erinnerung.
Rechtschreibung bleibt besser hängen, wenn mehrere Sinne gleichzeitig aktiv sind. Je mehr Sinneskanäle beteiligt sind, desto stabiler die Erinnerung.
- Schmecken: Ein Eiswürfel, ein saurer Drops, ein Center-Schock Kaugummi – der Geschmack wird zum kleinen Marker.
- Hören: Wörter laut sprechen, aufnehmen und über eine Boom-Box abspielen. So entsteht ein inneres Klangbild.
- Fühlen: Wörter aus Knete formen oder mit dem Finger in Mehl schreiben. Der Tastsinn aktiviert das Gedächtnis.
- Riechen: Düfte gezielt einsetzen – z.B. Riechstifte wie an der GVZH (Zitrone = Konzentration, Lavendel = Ruhe).
- Sehen: Wörter bunt gestalten und schwierige Stellen farbig markieren – das visuelle Muster prägt sich besonders ein.
Fazit: Rechtschreibung lässt sich nicht «pauken», sondern verstehen, erleben und verankern. Am besten mit Bewegung, Emotion, Sinnesreizen und kleinen Erfolgen.
Je lebendiger das Lernen, desto sicherer bleiben die Wörter.
Je lebendiger das Lernen, desto sicherer bleiben die Wörter.
Unser Kursangebot bei Gymivorbereitung Zürich zur Rechtschreibung
Immer wieder begleiten wir Kinder, die sich mit der Sprache schwertun. Mit der Rechtschreibung, mit dem Ausdruck oder einfach mit dem Gefühl, «nicht sprachstark genug» zu sein. Gerade beim Deutsch zeigt sich, wie sehr das System an Grenzen kommt: Bei der Gymiprüfung entscheidet oft nicht nur das Denken, sondern auch das Schreiben darüber, ob jemand den Übertritt schafft.
Aus dieser Beobachtung heraus und vor allem auf Wunsch der Eltern ist vor einigen Jahren unser 4.-Klasse-Kurs entstanden.
Er ist keine frühe «Gymivorbereitung» im klassischen Sinn, sondern ein behutsamer Aufbaukurs rund um Sprache, Lesen und Schreiben. Hier legen wir das Fundament: Rechtschreibregeln verstehen, Sprachgefühl entwickeln, Freude am Lesen entdecken, Grammatik begreifen, Ausdruckskraft üben.
Wir glauben, dass Sprachförderung Zeit braucht und dass diese Zeit sich lohnt.
Aus dieser Beobachtung heraus und vor allem auf Wunsch der Eltern ist vor einigen Jahren unser 4.-Klasse-Kurs entstanden.
Er ist keine frühe «Gymivorbereitung» im klassischen Sinn, sondern ein behutsamer Aufbaukurs rund um Sprache, Lesen und Schreiben. Hier legen wir das Fundament: Rechtschreibregeln verstehen, Sprachgefühl entwickeln, Freude am Lesen entdecken, Grammatik begreifen, Ausdruckskraft üben.
Wir glauben, dass Sprachförderung Zeit braucht und dass diese Zeit sich lohnt.
Schlusswort – mit scharfen Krallen durch den Bildungsdschungel
Zurück zum Anfang, zurück zur Frage: Warum schreibt man Tiger mit i?
«Tiger» ist ein sogenanntes Lernwort. Es wurde als Fremdwort aus dem Englischen übernommen und folgt daher nicht der deutschen Regel für den langen i-Laut im Silbenende. Im Deutschen gilt normalerweise: Ein lang gesprochenes i wird mit ie geschrieben. Also greift hier auch nicht das lautgetreue Schreiben. Da Tiger diese Regeln nicht befolgt, gehört es zu den Wörtern, die man sich einfach merken muss.
Ein schönes Beispiel also, warum Rechtschreibung mehr ist als blosses Hören. Man muss sie hinterfragen, verstehen… und notfalls halt einfach auch mal auswendig lernen.
Und genau darum geht es:
Wer schreiben kann, bewegt sich sicherer durch den Bildungsdschungel.
Rechtschreibkompetenz mag auf den ersten Blick nach Fleiss und Regelheft klingen. Doch sie ist weit mehr als das: Sie schenkt Kindern Ausdruckskraft, Selbstvertrauen und das gute Gefühl, etwas im Griff zu haben.
In unserer Geschichte wurde aus dem Tieger wieder ein Tiger.
Und vielleicht ist das die schönste Metapher: Kleine Fehler verlieren ihre Bedrohlichkeit, sobald man sie versteht.
Als Eltern können wir die Fackel entzünden und den Weg leuchten. Mit Geduld, Gelassenheit und dem Vertrauen, dass Fehler Helfer sind, besser zu werden. Unser Ziel ist kein fehlerfreies Kind, sondern ein junger Mensch, er an sich glaubt.
Manchmal braucht es uns Eltern als Bagheera, den Panther: wachsam, mahnend und richtungsweisend. Und manchmal als gemütlichen Bär: ruhig, gelassen und überzeugt davon, dass alles so kommt, wie es kommen muss.
Wir helfen unserem Kind, dranzubleiben, auch wenn der Rechtschreibdschungel dicht und voller Gefahren ist. Denn wenn es, was immer es tut, diesem mit Feuer im Herzen begegnet, wird es seinen Weg finden – und sich nicht von den Tigern des Lebens in die Flucht schlagen lassen. Sondern ihnen mutig entgegentreten.
Denn: wer die Sprache zähmt, zähmt den Tiger.
Und wer den Tiger reitet, braucht den Dschungel nicht zu fürchten.
Beste Grüsse
Sandra Zogg
Gymivorbereitung Zürich
«Tiger» ist ein sogenanntes Lernwort. Es wurde als Fremdwort aus dem Englischen übernommen und folgt daher nicht der deutschen Regel für den langen i-Laut im Silbenende. Im Deutschen gilt normalerweise: Ein lang gesprochenes i wird mit ie geschrieben. Also greift hier auch nicht das lautgetreue Schreiben. Da Tiger diese Regeln nicht befolgt, gehört es zu den Wörtern, die man sich einfach merken muss.
Ein schönes Beispiel also, warum Rechtschreibung mehr ist als blosses Hören. Man muss sie hinterfragen, verstehen… und notfalls halt einfach auch mal auswendig lernen.
Und genau darum geht es:
Wer schreiben kann, bewegt sich sicherer durch den Bildungsdschungel.
Rechtschreibkompetenz mag auf den ersten Blick nach Fleiss und Regelheft klingen. Doch sie ist weit mehr als das: Sie schenkt Kindern Ausdruckskraft, Selbstvertrauen und das gute Gefühl, etwas im Griff zu haben.
In unserer Geschichte wurde aus dem Tieger wieder ein Tiger.
Und vielleicht ist das die schönste Metapher: Kleine Fehler verlieren ihre Bedrohlichkeit, sobald man sie versteht.
Als Eltern können wir die Fackel entzünden und den Weg leuchten. Mit Geduld, Gelassenheit und dem Vertrauen, dass Fehler Helfer sind, besser zu werden. Unser Ziel ist kein fehlerfreies Kind, sondern ein junger Mensch, er an sich glaubt.
Manchmal braucht es uns Eltern als Bagheera, den Panther: wachsam, mahnend und richtungsweisend. Und manchmal als gemütlichen Bär: ruhig, gelassen und überzeugt davon, dass alles so kommt, wie es kommen muss.
Wir helfen unserem Kind, dranzubleiben, auch wenn der Rechtschreibdschungel dicht und voller Gefahren ist. Denn wenn es, was immer es tut, diesem mit Feuer im Herzen begegnet, wird es seinen Weg finden – und sich nicht von den Tigern des Lebens in die Flucht schlagen lassen. Sondern ihnen mutig entgegentreten.
Denn: wer die Sprache zähmt, zähmt den Tiger.
Und wer den Tiger reitet, braucht den Dschungel nicht zu fürchten.
Beste Grüsse
Sandra Zogg
Gymivorbereitung Zürich
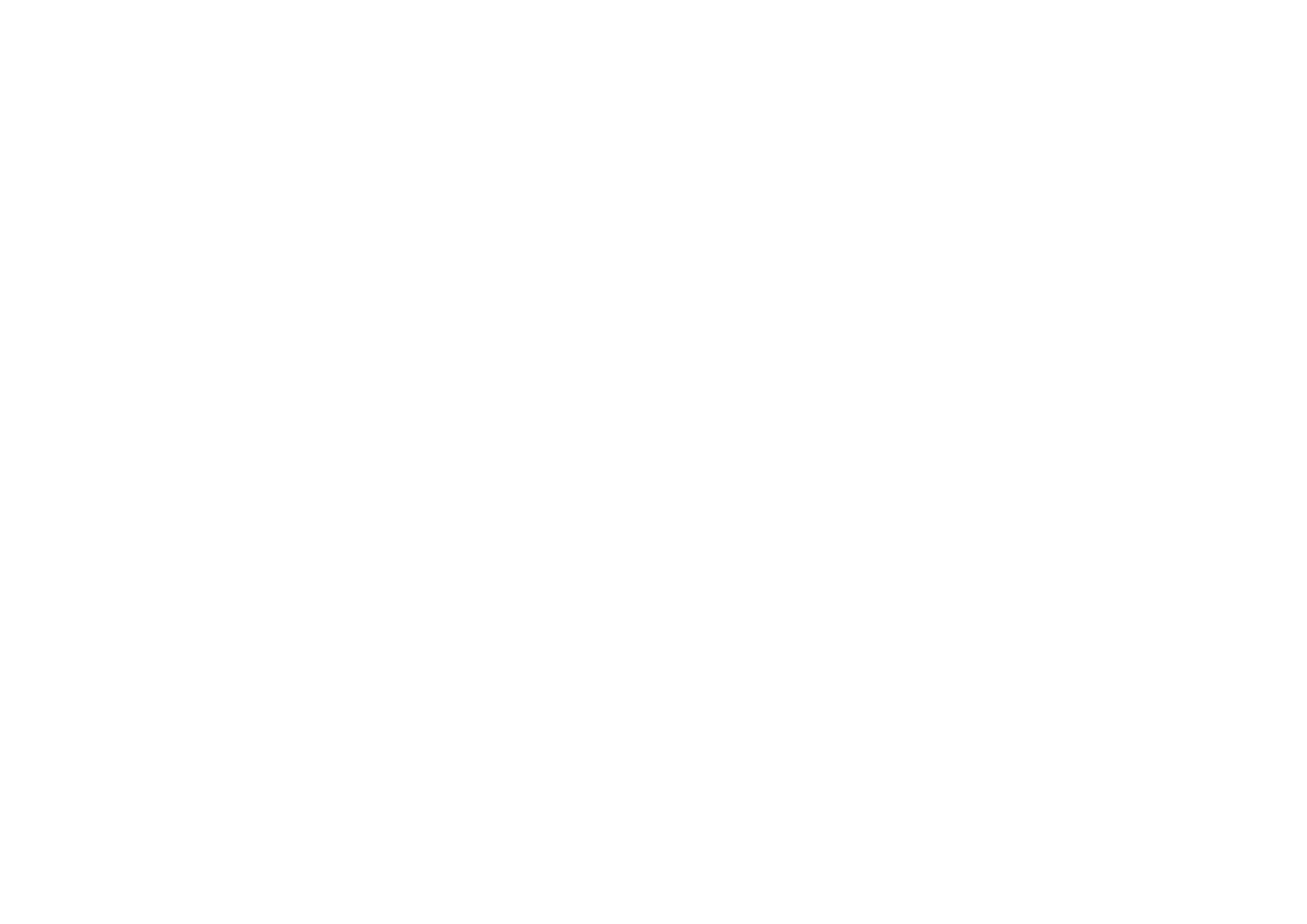
Quellen
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. ZAP Deutsch – Sprachprüfung & Musterlösungen 2025. (2025)
- Verwaltungsgericht Kanton Zürich (VB.2024.00434), Entscheid vom 26.09.2024. Berichte: nau.ch; Blue News; LawNews.
- EDK/ÜGK. Überprüfung der Grundkompetenzen 2023 – Orthografie, 11. Schuljahr. (2025).
- Steinig, W. / Betzel, D. Schreiben Grundschüler heute schlechter als vor 40 Jahren? (2013).
- Birkel, C. / Birkel, P. (2002). Wie einig sind sich Lehrer bei der Aufsatzbeurteilung?
- Psychologie in Erziehung und Unterricht, 49(3), 219-224.
- IRF FHNW. Studie zum Wortschatz-Halo-Effekt bei Aufsatzbewertungen. (O.J..).
- Deutsches Schulportal (2021). Rechtschreibung an Schulen rückt in den Fokus.
- Von St. Ange (2025), learnlearningwithcaroline.com
- Prosodiya (App Store, 2024). Prosodiya – Lesen & Schreiben (Förder-App).
Über uns
- Wir sind das Kompetenzzentrum für die Gymivorbereitung im Kanton Zürich.
- Bei uns unterrichten nur ausgebildete Lehrpersonen mit langjähriger Erfahrung rund um den Übertritt.
- Als kleines Lehrer:innen-Team ist für uns eine enge Betreuung zentral, weshalb wir auch ausserhalb der Kurszeiten für unsere Schüler:innen stets da sind.
- Struktur und Organisation sind fürs Gymnasium entscheidend – wir geben dies mit auf den Weg.
- Wir fördern die Selbstständigkeit sowie Eigenverantwortung Ihres Kindes und informieren Sie laufend über dessen Lernstand.
- Freude und Begeisterung sind uns wichtig.
- Wir begleiten Ihr Kind nicht nur fachlich, sondern auch mental auf dem Weg zur Gymiprüfung.
Unsere Kursstandorte
Unsere Kursstandorte befinden sich immer an sehr zentralen Lagen, welche ideal mit dem ÖV erreichbar sind. Unsere Schüler und Schülerinnen erwarten moderne Räumlichkeiten, welche mit den neusten Medien ausgestattet sind.
Unser Kursort direkt beim
Zürich Hauptbahnhof
Zürich Hauptbahnhof
Lagerstrasse 2
8090 Zürich
8090 Zürich
Unser Kursort direkt beim
Bahnhof Stadelhofen
Bahnhof Stadelhofen
Falkenstrasse 28A
8008 Zürich
8008 Zürich
Unser Kursort direkt beim
Bahnhof Winterthur
Bahnhof Winterthur
Schaffhauserstrasse 2
8400 Winterthur
8400 Winterthur