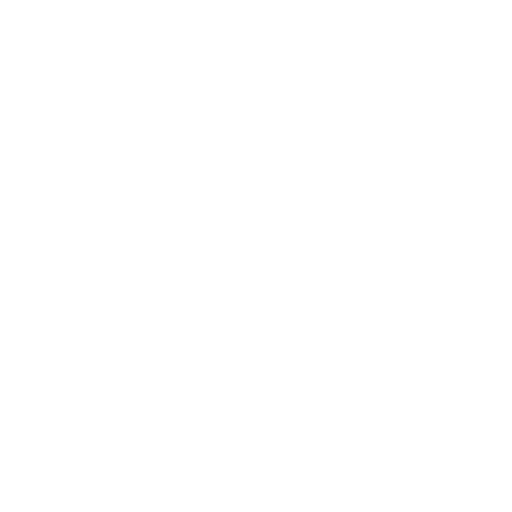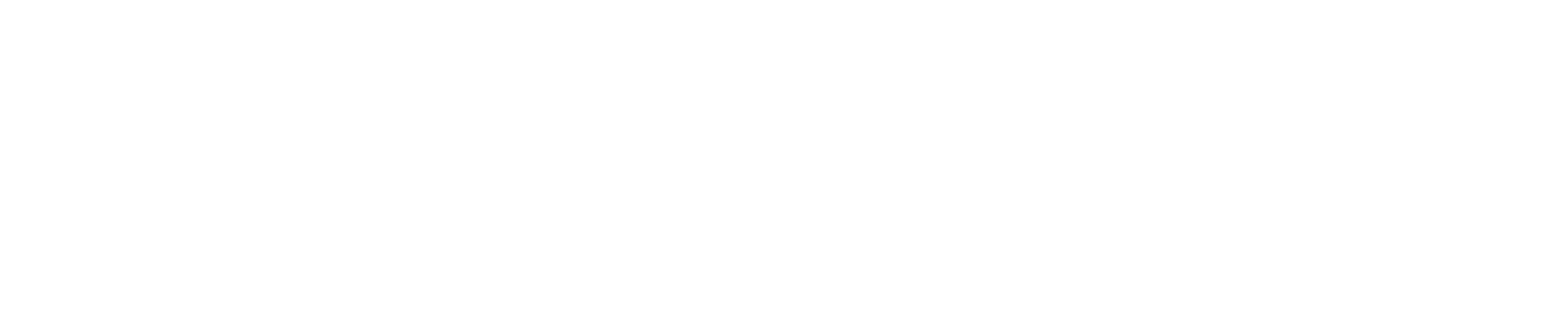Beratung?
Haben Sie Fragen zur Vorbereitung?
Wir beraten Sie gerne!
Wir beraten Sie gerne!
Lerncoaching für die Gymiprüfung
Selbstorganisation
in der Gymivorbereitung –
Woche und Halbjahr clever planen
Selbstorganisation ist der Schlüssel zur erfolgreichen Gymivorbereitung. Mit klaren Wochenplänen, cleveren Lernstrategien und festen Pausen meistern Schüler:innen den steigenden Druck von Schule, Prüfungen und Freizeit. Erfahre, wie dein Kind mit einfachen Methoden wie der Pomodoro-Technik, einer Halbjahresübersicht und bewusst geschützter Freizeit effizienter lernt, weniger Stress erlebt und seine Ziele souverän erreicht.
von: Sandra Zogg
von: Sandra Zogg
Warum Selbstorganisation für die Gymivorbereitung entscheidend ist
Ob in der 6. Klasse auf dem Weg zur Gymiprüfung oder bereits in der Sekundarschule mit Lehrstellensuche und Projektarbeiten: Die Anforderungen steigen deutlich. Mehr Schulstoff, häufigere Prüfungen - dazu Hobbys und Sozialleben. Viele Eltern erleben, dass Ihr Kind plötzlich im Spagat steckt zwischen Schule und Freizeit. Selbstorganisation ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Sie reduziert Stress, bringt Struktur in den Alltag und sorgt dafür, dass Schule, Lernen und Erholung im Gleichgewicht bleiben.
In unserer leistungsorientierten Zeit spüren Kinder und Jugendliche früh den Druck. Gemäss einer Schweizer Studie fühlt sich etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen gestresst projuventute.ch. Indem Schüler:innen lernen, ihre Zeit sinnvoll einzuteilen, schaffen sie ihre Aufgaben mit weniger Hektik und gewinnen freie Zeit für sich selbst zurück. Das Ergebnis: mehr Lernerfolg, weniger Stress und ein gesünderes Familienleben.
In unserer leistungsorientierten Zeit spüren Kinder und Jugendliche früh den Druck. Gemäss einer Schweizer Studie fühlt sich etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen gestresst projuventute.ch. Indem Schüler:innen lernen, ihre Zeit sinnvoll einzuteilen, schaffen sie ihre Aufgaben mit weniger Hektik und gewinnen freie Zeit für sich selbst zurück. Das Ergebnis: mehr Lernerfolg, weniger Stress und ein gesünderes Familienleben.
Wochenplan während der Gymivorbereitung
Ein Wochenplan schafft Orientierung, entlastet das Gedächtnis und bringt Ruhe in den Alltag. Statt jeden Tag spontan zu entscheiden, was noch erledigt werden muss, sorgt ein Plan dafür, dass nichts vergessen geht und unnötiger Stress vermieden wird. Das wichtigste Werkzeug dafür ist eine Agenda oder ein Kalender - egal ob auf Papier oder digital.
Besonders hilfreich ist, fixe Lernzeiten einzuplanen. Nicht nur für Hausaufgaben, sondern auch für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffs. Wer regelmässig kleine Portionen wiederholt und vertieft, lernt nachhaltiger, bleibt kontinuierlich am Ball und vermeidet Last-Minute-Stress vor Prüfungen.
«Wenn alles nur im Kopf umschwirrt, hab ich schon keine Lust mehr, bevor ich überhaupt anfange.»
Zitat von Mark W., anfangs 6. Klasse.
Fixe Blöcke eintragen: Zunächst sollten fixe Termine im Wochenplan stehen. Dazu gehören die Schulzeiten und regelmässige Hobbys (Training, Musikunterricht etc.) sowie bereits bekannte Prüfungstermine. In der Sekundarstufe kommen oft spezielle Anlässe hinzu (Schnupperlehren, Berufswahltage, Projektabgaben etc.) – auch diese sofort eintragen. Durch das Blocken aller festen Zeiten sieht man auf einen Blick, welche Nachmittage oder Abende tatsächlich für das Lernen frei bleiben. Das verhindert, dass Lernzeit überschätzt oder Freizeit «überbucht» wird.
Tipp: Nehmen Sie sich einmal pro Woche gemeinsam mit Ihrem Kind ein paar Minuten, um die Agenda durchzugehen. So stellen Sie sicher, dass alle neuen Termine erfasst sind und Ihr Kind gewinnt Sicherheit im Vorausplanen.
Besonders hilfreich ist, fixe Lernzeiten einzuplanen. Nicht nur für Hausaufgaben, sondern auch für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffs. Wer regelmässig kleine Portionen wiederholt und vertieft, lernt nachhaltiger, bleibt kontinuierlich am Ball und vermeidet Last-Minute-Stress vor Prüfungen.
«Wenn alles nur im Kopf umschwirrt, hab ich schon keine Lust mehr, bevor ich überhaupt anfange.»
Zitat von Mark W., anfangs 6. Klasse.
Fixe Blöcke eintragen: Zunächst sollten fixe Termine im Wochenplan stehen. Dazu gehören die Schulzeiten und regelmässige Hobbys (Training, Musikunterricht etc.) sowie bereits bekannte Prüfungstermine. In der Sekundarstufe kommen oft spezielle Anlässe hinzu (Schnupperlehren, Berufswahltage, Projektabgaben etc.) – auch diese sofort eintragen. Durch das Blocken aller festen Zeiten sieht man auf einen Blick, welche Nachmittage oder Abende tatsächlich für das Lernen frei bleiben. Das verhindert, dass Lernzeit überschätzt oder Freizeit «überbucht» wird.
Tipp: Nehmen Sie sich einmal pro Woche gemeinsam mit Ihrem Kind ein paar Minuten, um die Agenda durchzugehen. So stellen Sie sicher, dass alle neuen Termine erfasst sind und Ihr Kind gewinnt Sicherheit im Vorausplanen.
Pausen, Lernzeit und Pomodoro-Technik
Stundenlanges Durchpauken führt selten zum Erfolg. Viel wichtiger sind clevere Pausen und ein limitierter, aber konzentrierter Arbeitseinsatz. Studien und Erfahrungen aus der Lernpsychologie zeigen übereinstimmend, dass regelmässige Erholung die Lernleistung steigert mpg.de. Deshalb sollten Eltern und Schüler:innen gemeinsam darauf achten, dass Lernphasen sinnvoll begrenzt und von Pausen unterbrochen werden.
Pausen einplanen
Nach der Schule braucht das Gehirn erstmal eine Verschnaufpause. Gönnen Sie Ihrem Kind mind. 30 Minuten Pause, bevor es mit Hausaufgaben oder Lernen loslegt. Diese Erholungszeit ist fix und nicht verhandelbar. Sie dient dazu, erstmal abzuschalten, etwas zu essen, Musik zu hören, frische Luft zu schnappen oder sich zu bewegen. Danach geht das Lernen viel effizienter.
Wichtig: In dieser Pause sollten keine digitalen Ablenkungen wie Handy oder Computer dominieren. Diese Routine – erst auftanken, dann lernen – ermöglicht, vom Schulstress runterzukommen und steigert die Konzentrationsfähigkeit für den Nachmittag.
Auch während längerer Lernphasen zu Hause gilt: rechtzeitig Pausen machen! Spätestens nach ca. 25–45 Minuten konzentrierten Lernens (je nach Alter und Aufgabe) ist eine kurze Unterbrechung sinnvoll. Idealerweise verlässt man kurz den Schreibtisch: streckt sich, trinkt einen Schluck, lüftet das Zimmer. Kurze Pausen sind echte Konzentrations-Booster. Mit kurzen Unterbrechungen zwischendurch konnten Proband:innen ihre Aufmerksamkeit deutlich länger aufrechterhalten (siehe auch: annamariabeck.de).
Wichtig: In dieser Pause sollten keine digitalen Ablenkungen wie Handy oder Computer dominieren. Diese Routine – erst auftanken, dann lernen – ermöglicht, vom Schulstress runterzukommen und steigert die Konzentrationsfähigkeit für den Nachmittag.
Auch während längerer Lernphasen zu Hause gilt: rechtzeitig Pausen machen! Spätestens nach ca. 25–45 Minuten konzentrierten Lernens (je nach Alter und Aufgabe) ist eine kurze Unterbrechung sinnvoll. Idealerweise verlässt man kurz den Schreibtisch: streckt sich, trinkt einen Schluck, lüftet das Zimmer. Kurze Pausen sind echte Konzentrations-Booster. Mit kurzen Unterbrechungen zwischendurch konnten Proband:innen ihre Aufmerksamkeit deutlich länger aufrechterhalten (siehe auch: annamariabeck.de).
Lernzeit begrenzen
Weniger ist oft mehr. Maximal ca. 1.5 Stunden für die Primar und 2 Stunden für die Sek reichen als Lernzeit für die Gymivorbereitung pro Tag aus. Dabei empfehlen wir, mindestens ein Nachmittag "nur" Freizeit zu haben und auch ein Wochenendtag völlig der Freizeit zu widmen. Es gilt, lieber täglich kurze, fokussierte Lerneinheiten als stundenlange Marathons am Stück. So bleibt das Lernen effizient und das Kind brennt nicht aus vor Erschöpfung. Auch Lernpsychologen betonen, dass Qualität vor Quantität kommt (siehe auch: mit-kindern-lernen.ch). Dauerlernen ohne Ende ist kontraproduktiv. Zum einen nimmt die Konzentration nach einer gewissen Zeit rapide ab, zum anderen fehlt die Motivation, wenn kein Feierabend in Sicht ist. Indem die tägliche Lernzeit begrenzt wird, entsteht ein positiver Druck, diese Zeit auch wirklich zu nutzen. Viele Schüler:innen sind überrascht, wie viel sie in kürzerer, gut eingeteilter Zeit schaffen können, wenn sie wissen, dass der Rest des Tages frei ist. Und falls an einem Tag die angesetzten zwei Stunden nicht komplett benötigt werden, umso besser: Dann darf mit gutem Gewissen früher Schluss sein.
In Intervallen lernen (Pomodoro-Technik)
Eine bewährte Methode, Arbeit und Pausen in kleine Portionen abzuwechseln, ist die Pomodoro-Technik. Sie unterteilt das Lernen in kurze Intervalle von z.B. 25 Minuten (klassisch ein «Pomodoro») gefolgt von einer 5-minütigen Pause. Nach vier Durchgängen wird eine längere Pause von 20–30 Minuten eingelegt. Diese Vorgehensweise hilft auch unmotivierten Schüler:innen sich aufzuraffen. 25 Minuten klingen machbar, ein Ende ist absehbar und die nächste Pause kommt bestimmt. In den kurzen Pausen kann sich das Gehirn erholen ohne ganz aus dem Lernmodus zu fallen.
Wissenschaftliche Untersuchungen stützen die Effektivität solcher Intervall-Techniken: Studienteilnehmer:innen blieben fokussierter und erledigten mehr in gleicher Zeit –verglichen mit Kommilitonen, die flexible oder keine Pausen machten. (siehe auch: pubmed). Zudem fühlten sich die Student:innen mit der Pomodoro-Technik am Ende weniger erschöpft, obwohl sie in kürzerer Gesamtzeit gleich viel Inhalt lernten. Die Erklärung: Durch die künstliche Verknappung der Arbeitszeit wird pro Intervall konzentrierter gearbeitet und die regelmässigen Pausen halten die Motivation hoch.
Wissenschaftliche Untersuchungen stützen die Effektivität solcher Intervall-Techniken: Studienteilnehmer:innen blieben fokussierter und erledigten mehr in gleicher Zeit –verglichen mit Kommilitonen, die flexible oder keine Pausen machten. (siehe auch: pubmed). Zudem fühlten sich die Student:innen mit der Pomodoro-Technik am Ende weniger erschöpft, obwohl sie in kürzerer Gesamtzeit gleich viel Inhalt lernten. Die Erklärung: Durch die künstliche Verknappung der Arbeitszeit wird pro Intervall konzentrierter gearbeitet und die regelmässigen Pausen halten die Motivation hoch.
Leerzeit = Lehrzeit
Nach dem Lernen direkt ans Handy oder an die Konsole? Besser nicht! Denn genau diese Leerlaufzeit ist wertvolle Lehrzeit. Was paradox klingt, ist neurowissenschaftlich gut belegt. Das Gehirn braucht Phasen des Nichtstuns, um Gelerntes zu verarbeiten und im Gedächtnis abzuspeichern. Neu erworbenes Wissen haftet zunächst wie frischer Leim: formbar und noch nicht fest. Erst wenn wir dem Gehirn eine Weile Ruhe gönnen, kann der Klebstoff trocknen und stabile Verbindungen bilden. Bereits kurze Pausen reichen, das Gelernte im Kopf zu verfestigen und später zuverlässig abrufen zu können (siehe auch: cbs.mpg.de).
Hirnforscher haben gezeigt, dass längere Abstände zwischen Lerneinheiten dazu führen, dass das Gehirn beim Wiederholen verstärkt dieselben neuronalen Netzwerke nutzt und dadurch Verknüpfungen mit jeder Pause festigt (siehe auch: mpg.de). Mit anderen Worten: In den Momenten scheinbarer Untätigkeit arbeitet das Gehirn auf Hochtouren und Wissen bleibt länger hängen.
In der Praxis bedeutet das: nach einer Lerneinheit ca. 20–30 Minuten wirklich nichts für die Schule tun, auch kein Fernsehen oder Gaming. Denn diese Aktivitäten würden das frische Wissen sofort mit neuen Reizen überschreiben. Besser ist, kurz spazieren zu gehen, zu duschen, zu malen oder einfach zu entspannen. In dieser bildschirmfreien halben Stunde sortiert und speichert das Gehirn die zuvor gelernten Inhalte. Machen Eltern diese Bedeutung klar (z.B. mit Hilfe der Klebstoff-Metapher), verstehen Kinder eher, warum direkt nach der Lernzeit noch keine Medienzeit ist. Ein häufiger Konflikt wie «Ich will jetzt gamen!» lässt sich so entschärfen: «Dein Gehirn braucht erst kurz Ruhe, damit das Gelernte sich setzen kann. Danach macht das Gaming sogar noch mehr Spass.» Wenn Kinder erleben, dass sie nach einer Pause entspannter und erfolgreicher weiterlernen können, akzeptieren sie die Leerlauf-Phasen als festen Bestandteil ihres Lernrituals.
«Es war immer wieder derselbe Konflikt. Er kam von der Schule und wollte gamen, doch mir war es wichtig, dass zuerst die Hausaufgaben erledigt werden. Seit wir die Wochen gemeinsam planen, haben wir nun aber weniger Konflikte.»
Zitat von Birte W., Mutter eines 5. Klässlers.
Hirnforscher haben gezeigt, dass längere Abstände zwischen Lerneinheiten dazu führen, dass das Gehirn beim Wiederholen verstärkt dieselben neuronalen Netzwerke nutzt und dadurch Verknüpfungen mit jeder Pause festigt (siehe auch: mpg.de). Mit anderen Worten: In den Momenten scheinbarer Untätigkeit arbeitet das Gehirn auf Hochtouren und Wissen bleibt länger hängen.
In der Praxis bedeutet das: nach einer Lerneinheit ca. 20–30 Minuten wirklich nichts für die Schule tun, auch kein Fernsehen oder Gaming. Denn diese Aktivitäten würden das frische Wissen sofort mit neuen Reizen überschreiben. Besser ist, kurz spazieren zu gehen, zu duschen, zu malen oder einfach zu entspannen. In dieser bildschirmfreien halben Stunde sortiert und speichert das Gehirn die zuvor gelernten Inhalte. Machen Eltern diese Bedeutung klar (z.B. mit Hilfe der Klebstoff-Metapher), verstehen Kinder eher, warum direkt nach der Lernzeit noch keine Medienzeit ist. Ein häufiger Konflikt wie «Ich will jetzt gamen!» lässt sich so entschärfen: «Dein Gehirn braucht erst kurz Ruhe, damit das Gelernte sich setzen kann. Danach macht das Gaming sogar noch mehr Spass.» Wenn Kinder erleben, dass sie nach einer Pause entspannter und erfolgreicher weiterlernen können, akzeptieren sie die Leerlauf-Phasen als festen Bestandteil ihres Lernrituals.
«Es war immer wieder derselbe Konflikt. Er kam von der Schule und wollte gamen, doch mir war es wichtig, dass zuerst die Hausaufgaben erledigt werden. Seit wir die Wochen gemeinsam planen, haben wir nun aber weniger Konflikte.»
Zitat von Birte W., Mutter eines 5. Klässlers.
Freizeit bewusst schützen
Bei aller Planung und Lernerei darf eines nicht unter die Räder kommen: die Freizeit. Genau wie Lernzeit sollte auch Erholungszeit fest eingeplant und unbedingt eingehalten werden. Mindestens ein freier Nachmittag pro Woche sollte für Ihr Kind umverhandelbar sein: keine Schule, keine Nachhilfe, keine geplanten Pflichttermine. Ebenso empfehlenswert ist ein weitgehend freier Tag am Wochenende (häufig der Sonntag), welcher zu Erholung dient oder als Puffer, falls unter der Woche doch mal etwas liegen geblieben ist. Diese festen Freizeiten geben Kindern etwas, worauf sie sich freuen können und schützen vor dem Gefühl, ständig lernen zu müssen.
Denn ohne echte Erholung bricht die Leistung irgendwann ein. Wer nie Pausen macht, riskiert Überforderung und Frust. Viele Schüler:innen hängen selbst in ihrer vermeintlichen Freizeit gedanklich bei der Schule. Dieses Phänomen beschreibt F. Grolimund und S. Rietzler als «Müllzeit» (siehe auch: mit-kindern-lernen.ch). Ein ineffizienter Zustand, in dem weder richtig gelernt, noch richtig entspannt wird. Die Lösung ist radikal einfach: Freizeit wirklich freigeben! Wenn gelernt wird, dann konzentriert. Wenn frei ist, dann ohne Reue geniessen. Grolimund rät Schüler:innen, sich aktiv ein Lernverbot für gewisse Seiten zu erteilen. Zum Beispiel nach einer anstrengenden Schulwoche am Freitag gar nicht erst noch versuchen zu lernen, sondern sich bewusst auszuspannen. Das durchbricht die Aufschieberitis-Falle. Sobald Kinder verinnerlichen, dass Freizeit erlaubt (und sogar verordnet) ist, verschwindet das schlechte Gewissen. Sie können die freien Stunden wirklich zur Erholung nutzen und starten am nächsten Tag mit neuer Energie durch. Indem Eltern ebenso viel Wert auf die Einhaltung von Freizeit wie auf die von Lernzeit legen, signalisieren sie: Beide sind wichtig.
Praxis-Tipp: Vereinbaren Sie klare arbeitsfreie Phasen im Tag. Zum Beispiel: «Ab 19 Uhr wird nicht mehr für die Schule gearbeitet.» Solche Grenzen helfen, abends abzuschalten. Langfristig profitieren die Schulleistungen davon, wenn Körper und Kopf regelmässig runterfahren dürfen, statt ins Burn-out (und ja, leider ist Burn-out auch bei Kindern und Jugendlichen ein Thema!) zu rutschen.
Denn ohne echte Erholung bricht die Leistung irgendwann ein. Wer nie Pausen macht, riskiert Überforderung und Frust. Viele Schüler:innen hängen selbst in ihrer vermeintlichen Freizeit gedanklich bei der Schule. Dieses Phänomen beschreibt F. Grolimund und S. Rietzler als «Müllzeit» (siehe auch: mit-kindern-lernen.ch). Ein ineffizienter Zustand, in dem weder richtig gelernt, noch richtig entspannt wird. Die Lösung ist radikal einfach: Freizeit wirklich freigeben! Wenn gelernt wird, dann konzentriert. Wenn frei ist, dann ohne Reue geniessen. Grolimund rät Schüler:innen, sich aktiv ein Lernverbot für gewisse Seiten zu erteilen. Zum Beispiel nach einer anstrengenden Schulwoche am Freitag gar nicht erst noch versuchen zu lernen, sondern sich bewusst auszuspannen. Das durchbricht die Aufschieberitis-Falle. Sobald Kinder verinnerlichen, dass Freizeit erlaubt (und sogar verordnet) ist, verschwindet das schlechte Gewissen. Sie können die freien Stunden wirklich zur Erholung nutzen und starten am nächsten Tag mit neuer Energie durch. Indem Eltern ebenso viel Wert auf die Einhaltung von Freizeit wie auf die von Lernzeit legen, signalisieren sie: Beide sind wichtig.
Praxis-Tipp: Vereinbaren Sie klare arbeitsfreie Phasen im Tag. Zum Beispiel: «Ab 19 Uhr wird nicht mehr für die Schule gearbeitet.» Solche Grenzen helfen, abends abzuschalten. Langfristig profitieren die Schulleistungen davon, wenn Körper und Kopf regelmässig runterfahren dürfen, statt ins Burn-out (und ja, leider ist Burn-out auch bei Kindern und Jugendlichen ein Thema!) zu rutschen.
Halbjahresübersicht – das grosse Ganze im Blick
Neben dem Wochenplan hat sich eine Halbjahresübersicht bewährt, um das grosse Ganze im Auge zu behalten. Dabei handelt es sich um einen Kalender (z.B. in Posterform oder digital), der die wichtigsten Termine der kommenden Monate zeigt. Hier trägt mal alle bekannten Ereignisse ein, die über den normalen Wochenablauf hinausgehen. Dazu gehören:
Gerade viele schulische Termine stehen oft schon zu Schuljahresbeginn fest. Wenn Eltern und Kind diese sofort gemeinsam in die Halbjahresübersicht eintragen, entsteht frühzeitig ein Gesamtbild. Der Vorteil: Man erkennt Stressspitzen und Engpässe lange im Voraus. Wenn z.B. im März ein Musikschulkonzert auf dieselbe Woche fällt wie drei Prüfungen, kann man rechtzeitig gegensteuern. Etwa indem das Kind für die Konzertvorbereitung im Februar mehr übt, damit es im März weniger Zeit kostet. Die Übersicht verhindert böse Überraschungen: Alle sehen kommen, wann es turbulent wird und können sich darauf vorbereiten.
Hängen Sie die Halbjahresübersicht am besten gut sichtbar auf (z.B. am Kühlschrank oder im Kinderzimmer). So behält Ihr Kind stets das Grosse Ganze im Blick und lernt, langfristig zu planen. Eine Fähigkeit, die in Gymnasium oder Lehre noch wertvoller wird.
- Schulisches: Prüfungswochen oder -serien, standardisierte Tests (z.B. Stellwerk), Projektwochen, Klassenlager, Studienwochen, Elternabende oder berufskundliche Veranstaltungen.
- Familie: Urlaub oder Ferienzeit, Familienfeste wie Hochzeiten oder runde Geburtstage, Feiertage und andere schulfreie Tage.
- Freizeit: Wichtige Wettbewerbe, Turniere, Auftritte (z.B. Theater, Konzert, Sportmeisterschaft), Prüfungen in Musikschule oder Sport (Gürtelprüfungen, etc.), Lager von Vereinen,…
Gerade viele schulische Termine stehen oft schon zu Schuljahresbeginn fest. Wenn Eltern und Kind diese sofort gemeinsam in die Halbjahresübersicht eintragen, entsteht frühzeitig ein Gesamtbild. Der Vorteil: Man erkennt Stressspitzen und Engpässe lange im Voraus. Wenn z.B. im März ein Musikschulkonzert auf dieselbe Woche fällt wie drei Prüfungen, kann man rechtzeitig gegensteuern. Etwa indem das Kind für die Konzertvorbereitung im Februar mehr übt, damit es im März weniger Zeit kostet. Die Übersicht verhindert böse Überraschungen: Alle sehen kommen, wann es turbulent wird und können sich darauf vorbereiten.
Hängen Sie die Halbjahresübersicht am besten gut sichtbar auf (z.B. am Kühlschrank oder im Kinderzimmer). So behält Ihr Kind stets das Grosse Ganze im Blick und lernt, langfristig zu planen. Eine Fähigkeit, die in Gymnasium oder Lehre noch wertvoller wird.
Eltern als Begleiter – Unterstützung ohne Druck
Selbstorganisation will gelernt sein. Am Anfang brauchen viele Kinder dabei Unterstützung. Wichtig ist, dass Eltern eher begleiten, statt kontrollieren. Struktur bedeutet, dem Kind zu helfen, den Überblick zu behalten. Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie als Eltern die Selbstorganisation Ihres Kindes fördern können:
Wenn Eltern in dieser Weise unterstützen, erlebt das Kind die neu geschaffenen Strukturen nicht als zusätzlichen Druck sondern als echten Rückhalt. Es merkt: Meine Eltern vertrauen mir und stehen hinter mir. Schritt für Schritt wird Ihr Kind die Planung immer selbständiger übernehmen können. Ihr Job als Begleiter:in wird sein, bei Bedarf zu coachen, aber zunehmend loszulassen.
- Gemeinsam Planen: Schauen Sie (insbesondere bei jüngeren Kindern) regelmässig zusammen in die Agenda. Fragen Sie z.B. «Was steht diese Woche an? Welche Prüfungen kommen?». So stellen Sie sicher, dass nichts vergessen geht und das Kind lernt, wie man eine Woche strukturiert.
- Nachfragen statt Befehlen: Anstatt Anweisungen zu geben («Lerne jetzt Mathe!») lieber fragen: «Wann planst du, dich auf den Mathe-Test vorzubereiten?». Damit signalisieren Vertrauen in die Eigenverantwortung des Kindes. Es denkt selbst nach und trifft eine Entscheidung, was die Verbindlichkeit erhöht.
- Pausen und Freizeit respektieren: Wenn im Wochenplan Freizeitblock oder Pause steht, soll diese Zeit von allen respektiert werden. Vermeiden Sie Sätze wie: «Du konntest doch die Pause nutzen, schon Vokabeln zu lernen.» Genauso wie Sie erwarten, dass in der Lernzeit wirklich gelernt wird, muss in der Freizeit auch wirklich ausgeruht werden dürfen.
- Realistische Ziele und Geduld: Nicht jedes Kind wird über Nacht zum Organisationsprofi. Loben Sie kleine Fortschritte («Du hast diese Woche echt gut geplant, alles Wichtige eingetragen und gelernt!») und helfen Sie bei Misserfolgen mit konstruktiver Haltung. Wenn etwas schiefgeht (z.B. doch zu spät angefangen zu lernen für eine Prüfung), vermeiden Sie abwertende Kommentare wie «Typisch, du bist halt unorganisiert.» Stattdessen besprechen Sie gemeinsam, was man nächstes Mal besser planen könnte. So vermitteln Sie ein Lern- und Verbesserungsdenken.
- Growth Mindset (Wachstumsdenken) fördern: Die innere Einstellung spielt eine grosse Rolle. Machen Sie Ihrem Kind Mut, dass es durch Übung und clevere Strategien besser wird, anstatt zu glauben Organisationsfähigkeit und Intelligenz seien angeboren und unveränderlich (siehe auch: pubmed). Untersuchungen zeigen, dass Schüler:innen mit einem Growth Mindset motivierter an Herausforderungen herangehen und Rückschläge besser wegstecken. Feiern Sie daher die Anstrengungen und Lernfortschritte Ihres Kindes, selbst wenn mal etwas daneben geht. Die Botschaft lautet: Fehler sind Helfer – aus jeder Panne lässt sich etwas lernen.
Wenn Eltern in dieser Weise unterstützen, erlebt das Kind die neu geschaffenen Strukturen nicht als zusätzlichen Druck sondern als echten Rückhalt. Es merkt: Meine Eltern vertrauen mir und stehen hinter mir. Schritt für Schritt wird Ihr Kind die Planung immer selbständiger übernehmen können. Ihr Job als Begleiter:in wird sein, bei Bedarf zu coachen, aber zunehmend loszulassen.
Fazit
Selbstorganisation ist die Basis für eine erfolgreiche und entspannte Schulzeit, sowohl in der Gymivorbereitung als auch im weiteren Bildungsweg. Mit einem klaren Wochenplan, maximal ca. 2 Stunden konzentrierter Lernzeit pro Tag, der Pomodoro-Technik für regelmässige Pausen, bewusster Leerzeit zum Festigen des Gelernten, einer Halbjahresübersicht für den Weitblick und fix eingeplanten Freizeitblöcken schaffen Schüler:innen ein Gerüst, das sie enorm entlastet. Eltern können diesen Prozess durch Begleiten und Vertrauen unterstützen ohne micromanagen zu müssen.
Die zeitliche Investition in die Planung zahlt sich vielfach aus: Das Lernen wird effizienter, der Stressspiegel sinkt und die Freude an schulischen Erfolgen steigt. Vor allem aber erlebt Ihr Kind, dass Struktur nicht gleichbedeutend ist mit Druck, sondern im Gegenteil mehr Freiräume und Selbstbestimmung ermöglicht. So gelingt die Balance zwischen Schule, Lernen und Freizeit und am Ende des Tages bleibt auch Zeit, einfach mal Kind zu sein.
Die abschliessende, bewusst kritische Frage meinerseits, warum heutzutage sogar ein Primarschüler oder eine Primarschülerin einen Wochen- oder gar Halbjahresplan braucht, bleibt noch unbeantwortet - doch gerne werde ich mich dieser aus meiner Sicht grundlegenden Frage ein anderes Mal widmen.
Mit besten Grüssen,
Sandra Zogg
Inhaberin GVZH
Quellen: Experten wie Fabian Grolimund & Stefan Rietzler (Akademie für Lerncoaching), Forschungsergebnisse des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie und Kognitionswissenschaften, Carol Dweck (Stanford University) zum Growth Mindset und weitere in den obigen Referenzen.
Die zeitliche Investition in die Planung zahlt sich vielfach aus: Das Lernen wird effizienter, der Stressspiegel sinkt und die Freude an schulischen Erfolgen steigt. Vor allem aber erlebt Ihr Kind, dass Struktur nicht gleichbedeutend ist mit Druck, sondern im Gegenteil mehr Freiräume und Selbstbestimmung ermöglicht. So gelingt die Balance zwischen Schule, Lernen und Freizeit und am Ende des Tages bleibt auch Zeit, einfach mal Kind zu sein.
Die abschliessende, bewusst kritische Frage meinerseits, warum heutzutage sogar ein Primarschüler oder eine Primarschülerin einen Wochen- oder gar Halbjahresplan braucht, bleibt noch unbeantwortet - doch gerne werde ich mich dieser aus meiner Sicht grundlegenden Frage ein anderes Mal widmen.
Mit besten Grüssen,
Sandra Zogg
Inhaberin GVZH
Quellen: Experten wie Fabian Grolimund & Stefan Rietzler (Akademie für Lerncoaching), Forschungsergebnisse des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie und Kognitionswissenschaften, Carol Dweck (Stanford University) zum Growth Mindset und weitere in den obigen Referenzen.
Haben Sie gewusst?
In unseren Vorkursen von Mai bis Juli (5. Klasse oder 1. Sek) und in unserer halbjährigen Gymivorbereitung von September bis März (6. Klasse oder 2./3. Sek) ist – nebst den fachlichen Themen in Deutsch und Mathematik – ein Lerncoaching integriert. Dabei werden auch Themen wie Selbstorganisation und Wochenplanung besprochen.
In unseren Vorkursen von Mai bis Juli (5. Klasse oder 1. Sek) und in unserer halbjährigen Gymivorbereitung von September bis März (6. Klasse oder 2./3. Sek) ist – nebst den fachlichen Themen in Deutsch und Mathematik – ein Lerncoaching integriert. Dabei werden auch Themen wie Selbstorganisation und Wochenplanung besprochen.
Über uns
- Wir sind das Kompetenzzentrum für die Gymivorbereitung im Kanton Zürich.
- Bei uns unterrichten nur ausgebildete Lehrpersonen mit langjähriger Erfahrung rund um den Übertritt.
- Als kleines Lehrer:innen-Team ist für uns eine enge Betreuung zentral, weshalb wir auch ausserhalb der Kurszeiten für unsere Schüler:innen stets da sind.
- Struktur und Organisation sind fürs Gymnasium entscheidend – wir geben dies mit auf den Weg.
- Wir fördern die Selbstständigkeit sowie Eigenverantwortung Ihres Kindes und informieren Sie laufend über dessen Lernstand.
- Freude und Begeisterung sind uns wichtig.
- Wir begleiten Ihr Kind nicht nur fachlich, sondern auch mental auf dem Weg zur Gymiprüfung.
Unsere Kursstandorte
Unsere Kursstandorte befinden sich immer an sehr zentralen Lagen, welche ideal mit dem ÖV erreichbar sind. Unsere Schüler und Schülerinnen erwarten moderne Räumlichkeiten, welche mit den neusten Medien ausgestattet sind.
Unser Kursort direkt beim
Zürich Hauptbahnhof
Zürich Hauptbahnhof
Lagerstrasse 2
8090 Zürich
8090 Zürich
Unser Kursort direkt beim
Bahnhof Stadelhofen
Bahnhof Stadelhofen
Falkenstrasse 28A
8008 Zürich
8008 Zürich